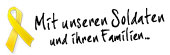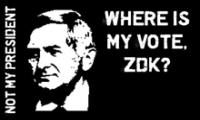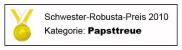Montag
Ich kannte Lorenzo bereits lange genug, um zu wissen, dass er seinen Aufenthalt im Krankenhaus relativ schnell relativ satt hatte.
Der caffè sei eine Zumutung, das Essen schlimmer als ein Alptraum, die penetrante Anwesenheit Estefanios an seinem Krankenbett der Nagel zu seinem Sarg und die Aufmerksamkeit, mit der ihn die Kurie überschütte, perfider als das Attentat selbst. Er käme überhaupt nicht mehr zu sich, wenn er weiterhin im Gemelli Krankenhaus diese unendliche Reihe von Zumutungen erdulden müsse, in der Tat hätte sich bereits eine allergische Reaktion gezeigt, er müsse, kurz und gut, sofort hier raus, sonst würde er den Rest seiner Tage mit einer entstellenden chronischen HAUTkrankheit zubringen, woran er nicht das geringste Interesse habe. Die Ärzte zeigten sich unwillig, beugten sich aber schließlich seinem Psychoterror und ließen ihn ein Formular unterschreiben, nach welchem seine Entlassung auf eigene Verantwortung erfolge.
„Was ist?“, fuhr er mich an, als ich ihn, im Rollstuhl, zu Roglers Jeep rollerte, die Tasche mit seinen Kleidern sorgfältig auf seinen Schoß gebettet.
„Sie können ein solches launenhaftes Scheusal sein!“, flüsterte ich, herunter gebeugt, an seinem rechten Ohr.
„Darf ich Sie daran erinnern, dass ich OPFER eines Anschlags geworden bin? Oh nein, ich meine nicht das Attentat auf meinen Körper, ich meine den Anschlag auf meine Sinne, meinen Verstand, diese Belagerungssituation in der Klinik, das Kardinalskollegium schickt mir Birnen und Traubensaft, der Heilige Vater betet öffentlich für meine Genesung, ich darf nicht einmal mehr rauchen, ich werde gleich WAHNSINNIG!“, schnappte er und versuchte sich wutentbrannt zu erheben. Ich drückte ihn brutal von hinten wieder in seinen Rollstuhl zurück.
„Das reicht jetzt. Wir alle waren krank vor Sorge und Sie führen sich auf wie eine Diva! Sie nehmen jetzt sofort Ihre Medikamente und hören auf, sich so anzustellen!“ Ich drückte ihm die Schachtel mit den Antidepressiva in die Hand und wühlte fluchend in seiner Tasche nach den Beruhigungstabletten, die man uns mitgegeben hatte. Er blieb störrisch. Seufzend fingerte ich nach meinen Zigaretten, zündete eine an und schob sie ihm zwischen die Lippen, was ihn für die nächsten fünf Minuten ablenkte. Aber nur bis zu dem Zeitpunkt, als Hellebardier Rogler ihn aus dem Stuhl heben und in den Jeep setzen wollte.
„Lassen Sie das! Ich kann g e h en, haben Sie mich verstanden?“
„Gut“, erwiderte Rogler ungerührt. „Dann gehen Sie.“ Lorenzo mühte sich voller Ingrimm, aber das Ende vom Lied war, dass er sich keuchend am Dach des Jeeps abstützen musste und weder einen Schritt vor noch einen zurück tun konnte. Rogler hatte auf dem Fahrersitz Platz genommen, schaute stur nach vorn und rührte keinen Finger. Ich legte Lorenzo aufseufzend die Arme um die Schultern, stützte seine Hüfte und brachte es fertig, dass er halbwegs sanft auf den Rücksitz gleiten konnte. Ich begab mich auf den Beifahrersitz , schnallte mich an und ignorierte die negativen Schwingungen, die vom Fond zu uns nach vorne fluteten. Wir drei schwiegen verbissen. Irgendwann klappte ich den Schminkspiegel nach unten, kontrollierte meine Frisur und Lorenzos bleiches Gesicht mit dem vor Unmut starren Unterkiefer – und hatte ein Einsehen.
„Halten Sie dort vorne, ich will schnell einen caffè trinken, soll ich welchen mitbringen?“, fragte ich Rogler. Er wandte sich erfreut zu mir und bestellte ein Thunfischsandwich und einen Cappuccino. Lorenzo schmollte, weil er keine Extraeinladung bekommen hatte. Ich betrat die Bar, gab meine Bestellung auf und kam mit dem Gewünschten für Rogler zurück. Zuletzt drückte ich Lorenzo einen winzigen Becher mit caffè und viel Zucker in die Hand.
Er würdigte mich keines Blickes.
Mir wurde klar, dass ich für die sechs Stockwerke, die uns bevorstanden, Zenos charmante Hilfe anfordern musste.
<[109]
>[111]
<<[1]
Der caffè sei eine Zumutung, das Essen schlimmer als ein Alptraum, die penetrante Anwesenheit Estefanios an seinem Krankenbett der Nagel zu seinem Sarg und die Aufmerksamkeit, mit der ihn die Kurie überschütte, perfider als das Attentat selbst. Er käme überhaupt nicht mehr zu sich, wenn er weiterhin im Gemelli Krankenhaus diese unendliche Reihe von Zumutungen erdulden müsse, in der Tat hätte sich bereits eine allergische Reaktion gezeigt, er müsse, kurz und gut, sofort hier raus, sonst würde er den Rest seiner Tage mit einer entstellenden chronischen HAUTkrankheit zubringen, woran er nicht das geringste Interesse habe. Die Ärzte zeigten sich unwillig, beugten sich aber schließlich seinem Psychoterror und ließen ihn ein Formular unterschreiben, nach welchem seine Entlassung auf eigene Verantwortung erfolge.
„Was ist?“, fuhr er mich an, als ich ihn, im Rollstuhl, zu Roglers Jeep rollerte, die Tasche mit seinen Kleidern sorgfältig auf seinen Schoß gebettet.
„Sie können ein solches launenhaftes Scheusal sein!“, flüsterte ich, herunter gebeugt, an seinem rechten Ohr.
„Darf ich Sie daran erinnern, dass ich OPFER eines Anschlags geworden bin? Oh nein, ich meine nicht das Attentat auf meinen Körper, ich meine den Anschlag auf meine Sinne, meinen Verstand, diese Belagerungssituation in der Klinik, das Kardinalskollegium schickt mir Birnen und Traubensaft, der Heilige Vater betet öffentlich für meine Genesung, ich darf nicht einmal mehr rauchen, ich werde gleich WAHNSINNIG!“, schnappte er und versuchte sich wutentbrannt zu erheben. Ich drückte ihn brutal von hinten wieder in seinen Rollstuhl zurück.
„Das reicht jetzt. Wir alle waren krank vor Sorge und Sie führen sich auf wie eine Diva! Sie nehmen jetzt sofort Ihre Medikamente und hören auf, sich so anzustellen!“ Ich drückte ihm die Schachtel mit den Antidepressiva in die Hand und wühlte fluchend in seiner Tasche nach den Beruhigungstabletten, die man uns mitgegeben hatte. Er blieb störrisch. Seufzend fingerte ich nach meinen Zigaretten, zündete eine an und schob sie ihm zwischen die Lippen, was ihn für die nächsten fünf Minuten ablenkte. Aber nur bis zu dem Zeitpunkt, als Hellebardier Rogler ihn aus dem Stuhl heben und in den Jeep setzen wollte.
„Lassen Sie das! Ich kann g e h en, haben Sie mich verstanden?“
„Gut“, erwiderte Rogler ungerührt. „Dann gehen Sie.“ Lorenzo mühte sich voller Ingrimm, aber das Ende vom Lied war, dass er sich keuchend am Dach des Jeeps abstützen musste und weder einen Schritt vor noch einen zurück tun konnte. Rogler hatte auf dem Fahrersitz Platz genommen, schaute stur nach vorn und rührte keinen Finger. Ich legte Lorenzo aufseufzend die Arme um die Schultern, stützte seine Hüfte und brachte es fertig, dass er halbwegs sanft auf den Rücksitz gleiten konnte. Ich begab mich auf den Beifahrersitz , schnallte mich an und ignorierte die negativen Schwingungen, die vom Fond zu uns nach vorne fluteten. Wir drei schwiegen verbissen. Irgendwann klappte ich den Schminkspiegel nach unten, kontrollierte meine Frisur und Lorenzos bleiches Gesicht mit dem vor Unmut starren Unterkiefer – und hatte ein Einsehen.
„Halten Sie dort vorne, ich will schnell einen caffè trinken, soll ich welchen mitbringen?“, fragte ich Rogler. Er wandte sich erfreut zu mir und bestellte ein Thunfischsandwich und einen Cappuccino. Lorenzo schmollte, weil er keine Extraeinladung bekommen hatte. Ich betrat die Bar, gab meine Bestellung auf und kam mit dem Gewünschten für Rogler zurück. Zuletzt drückte ich Lorenzo einen winzigen Becher mit caffè und viel Zucker in die Hand.
Er würdigte mich keines Blickes.
Mir wurde klar, dass ich für die sechs Stockwerke, die uns bevorstanden, Zenos charmante Hilfe anfordern musste.
<[109]
>[111]
<<[1]
ElsaLaska - 22. Mai, 01:44