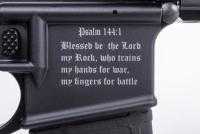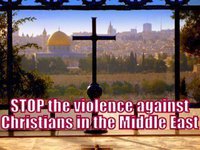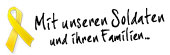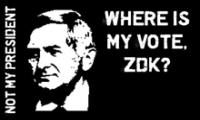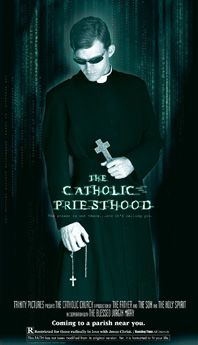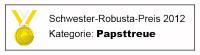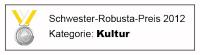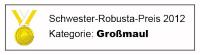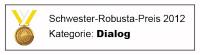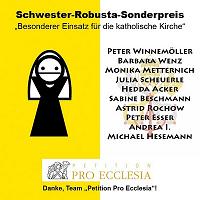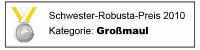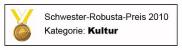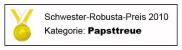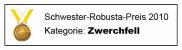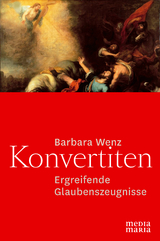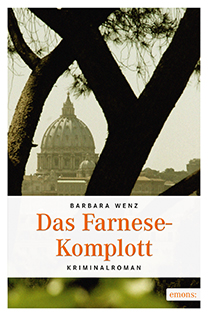Die Bundestagsrede und eine Erwiderung.
[Update: Es gibt jetzt auch eine Erwiderung auf Professor Dreier von Richard Estarriol. Man muss natürlich den ganzen Beitrag lesen, aber Estarriol zitiert nun ebenfalls nochmals Kelsen - und somit wird klar, dass der Heilige Vater in seiner Rede vor dem Bundestag eben doch nicht so schief gelegen hat, wie Professor Dreier behauptet:
>>In Erwiderung auf einen Einwand von Dozent Marcic hatte damals Kelsen gesagt:
"Ich habe in meinen früheren Schriften von Normen gesprochen, die nicht der Sinn von Willensakten sind. Meine ganze Lehre von der Grundnorm habe ich dargestellt als eine Norm, die nicht der Sinn eines Willensaktes ist, sondern die im Denken vorausgesetzt wird. Nun muss ich Ihnen leider gestehen, meine Herren, daß ich diese Lehre nicht mehr aufrechterhalten kann, daß ich diese Lehre aufgeben musste. Sie können mir glauben, daß es mir durchaus nicht leicht war, eine Lehre aufzugeben, die ich durch Jahrzehnte vertreten habe. Ich habe sie aufgegeben in der Erkenntnis, daß ein Sollen das Korrelat eines Wollens sein muss. Meine Grundnorm ist eine fiktive Norm, die einen fiktiven Willensakt voraussetzt, der diese Norm setzt. Es ist die Fiktion, dass irgendeine Autorität will, dass dies sein soll. Sie werfen mir mit Recht vor, dass ich gegen eine eigene, von mir selbst vertretene Lehre spreche. Das ist vollkommen richtig: Ich musste meine Lehre von der Grundnorm in ihrer Darstellung modifizieren. Es kann nicht bloß gedachte Normen geben, d. h. Normen, die der Sinn eines Denkaktes, nicht der Sinn eines Willensaktes sind. Was man sich bei der Grundnorm denkt, ist die Fiktion eines Willensaktes, der realiter nicht besteht."<<
Ganzer Kommentar von Richard Estarriol hier.]
Soweit ich es überblicke gab es bislang auf die Rede, die Benedikt XVI. im deutschen Bundestag am 22. September 2011 gehalten hat, nur einen einzigen deutschen Artikel, der den Ball aufgefangen und eine intellektuelle Erwiderung unternommen hat, und zwar von Professor Horst Dreier, einem Rechtsphilosophen, in der FAZ.
Zunächst möchte ich vorausschicken, dass ich nicht den Hauch einer Ahnung von Rechtsphilosophie habe, aber vielleicht versteht der eine oder andere Leser hier ja mehr vom Fach. Den Namen Hans Kelsen habe ich also zum ersten Mal gehört, Professor Dreier natürlich nicht, doch offenbar hat es sein Interesse geweckt, dass Benedikt XVI. diesen Rechtsphilosophen als einzigen modernen Autoren erwähnt hat, und das gleich zweimal. In seinem FAZ-Artikel vom 3. November gibt Professor Dreier dankenswerterweise auch gleich eine kurze Einführung in Leben und Werk von Hans Kelsen.
Das erste Kelsen-Zitat des Papstes lautet wie folgt - und weil ich es wichtig finde, den Gesamtzusammenhang zu wissen, in dem es innerhalb der Rede fällt, zitiere ich einen größeren Absatz:
>>Der Gedanke des Naturrechts gilt heute als eine katholische Sonderlehre, über die außerhalb des katholischen Raums zu diskutieren nicht lohnen würde, so daß man sich schon beinahe schämt, das Wort überhaupt zu erwähnen. Ich möchte kurz andeuten, wieso diese Situation entstanden ist. Grundlegend ist zunächst die These, daß zwischen Sein und Sollen ein unüberbrückbarer Graben bestehe. Aus Sein könne kein Sollen folgen, weil es sich da um zwei völlig verschiedene Bereiche handle. Der Grund dafür ist das inzwischen fast allgemein angenommene positivistische Verständnis von Natur. Wenn man die Natur – mit den Worten von H. Kelsen – als „ein Aggregat von als Ursache und Wirkung miteinander verbundenen Seinstatsachen“ ansieht, dann kann aus ihr in der Tat keine irgendwie geartete ethische Weisung hervorgehen.[4] Ein positivistischer Naturbegriff, der die Natur rein funktional versteht, so wie die Naturwissenschaft sie erkennt, kann keine Brücke zu Ethos und Recht herstellen, sondern wiederum nur funktionale Antworten hervorrufen. Das gleiche gilt aber auch für die Vernunft in einem positivistischen, weithin als allein wissenschaftlich angesehenen Verständnis. Was nicht verifizierbar oder falsifizierbar ist, gehört danach nicht in den Bereich der Vernunft im strengen Sinn. Deshalb müssen Ethos und Religion dem Raum des Subjektiven zugewiesen werden und fallen aus dem Bereich der Vernunft im strengen Sinn des Wortes heraus. Wo die alleinige Herrschaft der positivistischen Vernunft gilt – und das ist in unserem öffentlichen Bewußtsein weithin der Fall –, da sind die klassischen Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft gesetzt. Dies ist eine dramatische Situation, die alle angeht und über die eine öffentliche Diskussion notwendig ist, zu der dringend einzuladen eine wesentliche Absicht dieser Rede bildet.<< Quelle.
Prof. Dreier interpretiert dieses Zitat in der Richtung, dass Kelsen offenbar als ein besonders strikter Vertreter eines Dualismus zwischen Sein und Sollen betrachtet werde. "Irritiertes Befremden" habe das Staunen über die Erwähnung Kelsens dann durch folgende Stelle, es ist die zweite Nennung innerhalb der Papstrede, ausgelöst:
>>Der große Theoretiker des Rechtspositivismus, Kelsen, hat im Alter von 84 Jahren – 1965 – den Dualismus von Sein und Sollen aufgegeben. (Es tröstet mich, daß man mit 84 Jahren offenbar noch etwas Vernünftiges denken kann.) Er hatte früher gesagt, daß Normen nur aus dem Willen kommen können. Die Natur könnte folglich Normen nur enthalten – so fügt er hinzu –, wenn ein Wille diese Normen in sie hineingelegt hätte. Dies wiederum – sagt er – würde einen Schöpfergott voraussetzen, dessen Wille in die Natur miteingegangen ist. „Über die Wahrheit dieses Glaubens zu diskutieren, ist völlig aussichtslos“, bemerkt er dazu.[5] Wirklich? – möchte ich fragen. Ist es wirklich sinnlos zu bedenken, ob die objektive Vernunft, die sich in der Natur zeigt, nicht eine schöpferische Vernunft, einen Creator Spiritus voraussetzt?<<
[Quelle wie oben und der Zusatz in den runden Klammern ist nicht etwa von mir, sondern das hat Benedikt wirklich schmunzelnd eingeschoben gesagt.]
Professor Dreier geht es nun konkret um die Aussage, Kelsen hätte den Dualismus von Sein und Sollen aufgegeben - der er vehement widerspricht. Im FAZ-Artikel führt er aus:
>>Zwei Normen mit einander logisch ausschließendem Inhalt konnten dieser lange Zeit von ihm vertretenen Position zufolge nicht gleichzeitig gelten - genauso wie zwei widersprüchliche Aussagen nach Art von "A existiert" und "A existiert nicht" unmöglich beide zutreffend sein konnten. Von dieser Anwendung logischer Regeln auf Rechtsnormen - und nicht vom Dualismus von Sein und Sollen - verabschiedet er sich in den 1960er Jahren. Seine Position lautet nun, dass sich die Regeln der Logik auf widersprüchliche Normen nicht anwenden ließen. Im Hintergrund steht seine neu gewonnene Überzeugung, wonach logische Prinzipien nur auf Aussagen Anwendung finden können, die wahr oder unwahr sind. Normen hingegen statuierten ein Sollen und können daher weder wahr noch unwahr sein. Ihr Existenzmodus ist der der Geltung. Normen sind nicht wahr oder unwahr, sondern sie gelten oder sie gelten nicht. Und da jede Norm dem späten Kelsen zufolge auf einem Willensakt beruht, widersprüchliche Willensakte unterschiedlicher Normsetzer aber ohne weiteres denkbar sind, können zwei miteinander in Konflikt stehende Rechtsnormen durchaus jeweils für sich Geltung beanspruchen. Mit Mitteln der Logik sei ein solcher Konflikt nicht zu lösen. Der Rechtswissenschaft bliebe von daher nur der Weg, die Existenz solcher miteinander unvereinbarer Normen zu beschreiben; den Normenkonflikt aus eigener Kraft qua Anwendung logischer Regeln zu lösen käme ihr nicht zu.<< Quelle.
Sein Fazit: Kelsen habe sich nicht etwa vom Sein-Sollen-Dualismus verabschiedet, sondern diesen noch vielmehr verschärft, in dem er nun die Regeln der Logik nur noch im Bereich des Seins gelten lassen wolle, nicht aber für den Sollensbereich.
Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass Professor Dreier der kompetentere Kelsen-Kenner ist und seine Ausführungen sind, soweit ich sie ihnen folgen kann jedenfalls, schlüssig.
Ich meine nur, dem Papst ging es eigentlich, in seiner Eigenschaft als Theologe, um einen ganz anderen Zusammenhang: Für ihn - immer als Theologe! - war ja der springende Punkt, dass Kelsen in hohem Alter wohl in Erwägung zog, dass sich im Sein selbst insofern Normen manifestieren könnten, wenn ein Wille - also ein Schöpfergott - diese bereit darin angelegt hätte. Daran schließt sich ja sofort das Zitat an, dass man über diese Wahrheit des Glaubens nicht diskutieren könne. Aus dieser Perspektive betrachtet und in diesem Zusammenhang gesehen, lässt sich die Rede von der "Aufgabe des Dualismus von Sein und Sollen", auch wenn sie denjenigen, der aus rechtsphilosophisch-fachlichen Gründen mit Kelsens Werk bestens vertraut ist, irritieren mag, durchaus rechtfertigen.
Während also Professor Dreier sozusagen werkimmanent Kelsen interpretiert, schaut der Heilige Vater aus philosophisch-theologischer Sicht auf dessen Aussage.
Somit hätten aber doch beide, Dreier wie Ratzinger, recht mit ihrer Darstellung?
*grübelt*
>>In Erwiderung auf einen Einwand von Dozent Marcic hatte damals Kelsen gesagt:
"Ich habe in meinen früheren Schriften von Normen gesprochen, die nicht der Sinn von Willensakten sind. Meine ganze Lehre von der Grundnorm habe ich dargestellt als eine Norm, die nicht der Sinn eines Willensaktes ist, sondern die im Denken vorausgesetzt wird. Nun muss ich Ihnen leider gestehen, meine Herren, daß ich diese Lehre nicht mehr aufrechterhalten kann, daß ich diese Lehre aufgeben musste. Sie können mir glauben, daß es mir durchaus nicht leicht war, eine Lehre aufzugeben, die ich durch Jahrzehnte vertreten habe. Ich habe sie aufgegeben in der Erkenntnis, daß ein Sollen das Korrelat eines Wollens sein muss. Meine Grundnorm ist eine fiktive Norm, die einen fiktiven Willensakt voraussetzt, der diese Norm setzt. Es ist die Fiktion, dass irgendeine Autorität will, dass dies sein soll. Sie werfen mir mit Recht vor, dass ich gegen eine eigene, von mir selbst vertretene Lehre spreche. Das ist vollkommen richtig: Ich musste meine Lehre von der Grundnorm in ihrer Darstellung modifizieren. Es kann nicht bloß gedachte Normen geben, d. h. Normen, die der Sinn eines Denkaktes, nicht der Sinn eines Willensaktes sind. Was man sich bei der Grundnorm denkt, ist die Fiktion eines Willensaktes, der realiter nicht besteht."<<
Ganzer Kommentar von Richard Estarriol hier.]
Soweit ich es überblicke gab es bislang auf die Rede, die Benedikt XVI. im deutschen Bundestag am 22. September 2011 gehalten hat, nur einen einzigen deutschen Artikel, der den Ball aufgefangen und eine intellektuelle Erwiderung unternommen hat, und zwar von Professor Horst Dreier, einem Rechtsphilosophen, in der FAZ.
Zunächst möchte ich vorausschicken, dass ich nicht den Hauch einer Ahnung von Rechtsphilosophie habe, aber vielleicht versteht der eine oder andere Leser hier ja mehr vom Fach. Den Namen Hans Kelsen habe ich also zum ersten Mal gehört, Professor Dreier natürlich nicht, doch offenbar hat es sein Interesse geweckt, dass Benedikt XVI. diesen Rechtsphilosophen als einzigen modernen Autoren erwähnt hat, und das gleich zweimal. In seinem FAZ-Artikel vom 3. November gibt Professor Dreier dankenswerterweise auch gleich eine kurze Einführung in Leben und Werk von Hans Kelsen.
Das erste Kelsen-Zitat des Papstes lautet wie folgt - und weil ich es wichtig finde, den Gesamtzusammenhang zu wissen, in dem es innerhalb der Rede fällt, zitiere ich einen größeren Absatz:
>>Der Gedanke des Naturrechts gilt heute als eine katholische Sonderlehre, über die außerhalb des katholischen Raums zu diskutieren nicht lohnen würde, so daß man sich schon beinahe schämt, das Wort überhaupt zu erwähnen. Ich möchte kurz andeuten, wieso diese Situation entstanden ist. Grundlegend ist zunächst die These, daß zwischen Sein und Sollen ein unüberbrückbarer Graben bestehe. Aus Sein könne kein Sollen folgen, weil es sich da um zwei völlig verschiedene Bereiche handle. Der Grund dafür ist das inzwischen fast allgemein angenommene positivistische Verständnis von Natur. Wenn man die Natur – mit den Worten von H. Kelsen – als „ein Aggregat von als Ursache und Wirkung miteinander verbundenen Seinstatsachen“ ansieht, dann kann aus ihr in der Tat keine irgendwie geartete ethische Weisung hervorgehen.[4] Ein positivistischer Naturbegriff, der die Natur rein funktional versteht, so wie die Naturwissenschaft sie erkennt, kann keine Brücke zu Ethos und Recht herstellen, sondern wiederum nur funktionale Antworten hervorrufen. Das gleiche gilt aber auch für die Vernunft in einem positivistischen, weithin als allein wissenschaftlich angesehenen Verständnis. Was nicht verifizierbar oder falsifizierbar ist, gehört danach nicht in den Bereich der Vernunft im strengen Sinn. Deshalb müssen Ethos und Religion dem Raum des Subjektiven zugewiesen werden und fallen aus dem Bereich der Vernunft im strengen Sinn des Wortes heraus. Wo die alleinige Herrschaft der positivistischen Vernunft gilt – und das ist in unserem öffentlichen Bewußtsein weithin der Fall –, da sind die klassischen Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft gesetzt. Dies ist eine dramatische Situation, die alle angeht und über die eine öffentliche Diskussion notwendig ist, zu der dringend einzuladen eine wesentliche Absicht dieser Rede bildet.<< Quelle.
Prof. Dreier interpretiert dieses Zitat in der Richtung, dass Kelsen offenbar als ein besonders strikter Vertreter eines Dualismus zwischen Sein und Sollen betrachtet werde. "Irritiertes Befremden" habe das Staunen über die Erwähnung Kelsens dann durch folgende Stelle, es ist die zweite Nennung innerhalb der Papstrede, ausgelöst:
>>Der große Theoretiker des Rechtspositivismus, Kelsen, hat im Alter von 84 Jahren – 1965 – den Dualismus von Sein und Sollen aufgegeben. (Es tröstet mich, daß man mit 84 Jahren offenbar noch etwas Vernünftiges denken kann.) Er hatte früher gesagt, daß Normen nur aus dem Willen kommen können. Die Natur könnte folglich Normen nur enthalten – so fügt er hinzu –, wenn ein Wille diese Normen in sie hineingelegt hätte. Dies wiederum – sagt er – würde einen Schöpfergott voraussetzen, dessen Wille in die Natur miteingegangen ist. „Über die Wahrheit dieses Glaubens zu diskutieren, ist völlig aussichtslos“, bemerkt er dazu.[5] Wirklich? – möchte ich fragen. Ist es wirklich sinnlos zu bedenken, ob die objektive Vernunft, die sich in der Natur zeigt, nicht eine schöpferische Vernunft, einen Creator Spiritus voraussetzt?<<
[Quelle wie oben und der Zusatz in den runden Klammern ist nicht etwa von mir, sondern das hat Benedikt wirklich schmunzelnd eingeschoben gesagt.]
Professor Dreier geht es nun konkret um die Aussage, Kelsen hätte den Dualismus von Sein und Sollen aufgegeben - der er vehement widerspricht. Im FAZ-Artikel führt er aus:
>>Zwei Normen mit einander logisch ausschließendem Inhalt konnten dieser lange Zeit von ihm vertretenen Position zufolge nicht gleichzeitig gelten - genauso wie zwei widersprüchliche Aussagen nach Art von "A existiert" und "A existiert nicht" unmöglich beide zutreffend sein konnten. Von dieser Anwendung logischer Regeln auf Rechtsnormen - und nicht vom Dualismus von Sein und Sollen - verabschiedet er sich in den 1960er Jahren. Seine Position lautet nun, dass sich die Regeln der Logik auf widersprüchliche Normen nicht anwenden ließen. Im Hintergrund steht seine neu gewonnene Überzeugung, wonach logische Prinzipien nur auf Aussagen Anwendung finden können, die wahr oder unwahr sind. Normen hingegen statuierten ein Sollen und können daher weder wahr noch unwahr sein. Ihr Existenzmodus ist der der Geltung. Normen sind nicht wahr oder unwahr, sondern sie gelten oder sie gelten nicht. Und da jede Norm dem späten Kelsen zufolge auf einem Willensakt beruht, widersprüchliche Willensakte unterschiedlicher Normsetzer aber ohne weiteres denkbar sind, können zwei miteinander in Konflikt stehende Rechtsnormen durchaus jeweils für sich Geltung beanspruchen. Mit Mitteln der Logik sei ein solcher Konflikt nicht zu lösen. Der Rechtswissenschaft bliebe von daher nur der Weg, die Existenz solcher miteinander unvereinbarer Normen zu beschreiben; den Normenkonflikt aus eigener Kraft qua Anwendung logischer Regeln zu lösen käme ihr nicht zu.<< Quelle.
Sein Fazit: Kelsen habe sich nicht etwa vom Sein-Sollen-Dualismus verabschiedet, sondern diesen noch vielmehr verschärft, in dem er nun die Regeln der Logik nur noch im Bereich des Seins gelten lassen wolle, nicht aber für den Sollensbereich.
Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass Professor Dreier der kompetentere Kelsen-Kenner ist und seine Ausführungen sind, soweit ich sie ihnen folgen kann jedenfalls, schlüssig.
Ich meine nur, dem Papst ging es eigentlich, in seiner Eigenschaft als Theologe, um einen ganz anderen Zusammenhang: Für ihn - immer als Theologe! - war ja der springende Punkt, dass Kelsen in hohem Alter wohl in Erwägung zog, dass sich im Sein selbst insofern Normen manifestieren könnten, wenn ein Wille - also ein Schöpfergott - diese bereit darin angelegt hätte. Daran schließt sich ja sofort das Zitat an, dass man über diese Wahrheit des Glaubens nicht diskutieren könne. Aus dieser Perspektive betrachtet und in diesem Zusammenhang gesehen, lässt sich die Rede von der "Aufgabe des Dualismus von Sein und Sollen", auch wenn sie denjenigen, der aus rechtsphilosophisch-fachlichen Gründen mit Kelsens Werk bestens vertraut ist, irritieren mag, durchaus rechtfertigen.
Während also Professor Dreier sozusagen werkimmanent Kelsen interpretiert, schaut der Heilige Vater aus philosophisch-theologischer Sicht auf dessen Aussage.
Somit hätten aber doch beide, Dreier wie Ratzinger, recht mit ihrer Darstellung?
*grübelt*
ElsaLaska - 14. Nov, 15:17