Räsonnieren ohne Seinskontakt.
In seiner Abhandlung "Der Sinn philosophischen Fragens und Erkennens" unternimmt Dietrich von Hildebrand eine Untersuchung des Erkennens als Urphänomen, stellt dabei grundlegend fest, dass das Erkennen nicht gedacht werden kann ohne ein bewusstes Sein, ohne ein personales Subjekt, ein bewusst Seiendes.
Er unterscheidet den Vorgang des Erkennens scharf vom Urteilen, vom Überzeugen und Behaupten. In einem weiteren Schritt arbeitet er heraus, dass die Grundformen der Erkenntnis in der Kenntnisnahme und im Haben des erkannten Gegenstandes bestehen. In einem dritten Abschnitt - um den geht es hier - grenzt er die Eigenart des philosophischen Erkennens gegenüber dem "vorwissenschaftlichen Erkennen" ab. Dabei führt er den Terminus "naives vorwissenschaftliches Erkennen" ein, was keine Wertung beinhaltet, sondern lediglich meint, dass es sich dabei um eine Art der Wahrnehmung handelt, die nicht vom Thema der Kenntnisnahme erfüllt ist, die geschieht, ohne dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, es erfolgt wie nebenbei, und ist somit unsystematisch und unkritisch. (Etwa wenn eine Köchin feststellt: Das Wasser kocht.) Eine weitere Unterart des vorwissenschaftlichen Erkennens ist das theoretische vorwissenschaftliche Erkennen, welches nicht den Gegenstand selbst sprechen lässt, sondern ihn durch Erfahrungen, Beobachtungen, Überlegungen und Schlüsse zu erfassen sucht. Diese Form hat wiederum zwei Modi, nämlich den organischen und den anorganischen Typus. Die Präliminarien sind umständlich, braucht es aber, um das folgende Zitat richtig einordnen und verstehen zu können:
>>Das Anorganische dieses theoretischen Erkennens liegt auf der Hand. Es knüpft nicht an das naive Kenntnisnehmen an, sondern es setzt sich souverän darüber hinweg.
Es geht nur ganz von "außen" und ohne jeden unmittelbaren Sachkontakt an das Seiende heran. Bei dieser Art theoretischen außerwissenschaftlichen und außerphilosophischen Erkennens wird der naive Sachkontakt entweder bewußt ausgeschaltet, was fälschlich für spezifisch kritisch gehalten wird, oder der naive Sachkontakt wird unvermerkt ignoriert; immer geht man von allgemeinen, scheinbar evidenten Tatbeständen aus und deduziert aus ihnen.
Jemand argumentiert etwa: Alle sittlichen Werte sind relativ; denn verschiedene Völker und Zeiten halten jeweils entgegengesetzte Haltungen für gut und schlecht. Hier wird mit völliger Ignorierung des im naiven Sachkontakt vorliegenden Aspektes der Werte von außen her, aus einer Prämisse, die man von anderen ohne tieferes Verstehen dieses eigentlichen Tatbestandes übernommen, in völlig unkritischer Weise gefolgert. Denn die Verschiedenheit vieler Ansichten über gut und bös präjudiziert ja an sich noch nichts in bezug auf die Relativität der Werte. Oder jemand argumentiert: Alle Werte sind relativ; denn wir können doch nicht mehr erkennen, als was uns so erscheint; in dem wir es erkennen, ist es doch immer auf unser subjektives Erkenntnisvermögen relativ. Hier wird eine einer falschen Philosophie entstammende Scheinselbstverständlichkeit kritiklos als Prämisse zugrundegelegt, und man hält sich dabei für besonders kritisch, weil man sich über den im naiven Sachkontakt vorliegenden Aspekt erhebt. Daß man im nächsten Augenblick über das sittliche Verhalten eines Menschen empört ist und damit den sittlichen Wert als etwas Objektives behandelt, wird entweder gar nicht bemerkt oder nicht als etwas empfunden, was uns stutzig zu machen braucht. Denn dieser Typus hält prinzipiell sein theoretisches Erkennen, das sich aus nicht stringenten Schlüssen, aus ungeprüften Prämissen ergibt, für viel vertrauenswürdiger als das naive Kenntnisnehmen.
In diesem anorganischen theoretischen vorwissenschaftlichen Erkennen ist die Heimat alles Dilettantismus, aller Scheinselbstverständlichkeit, aller "Kurzschlüsse", alles fadenscheinigen rationalistischen Theoretisierens. Hier wirkt sich die mangelnde Kritik in prinzipiell verhängnisvollerer Weise aus als beim naiven Kenntnisnehmen und selbst als beim organischen theoretischen Erkennen. Denn hier wird ein Geistesregister gezogen, dessen Bedeutung mit dem Grad echter Kritik steht und fällt. <<
Aus: Dietrich von Hildebrand: Der Sinn philosophischen Fragens und Erkennens.
Er unterscheidet den Vorgang des Erkennens scharf vom Urteilen, vom Überzeugen und Behaupten. In einem weiteren Schritt arbeitet er heraus, dass die Grundformen der Erkenntnis in der Kenntnisnahme und im Haben des erkannten Gegenstandes bestehen. In einem dritten Abschnitt - um den geht es hier - grenzt er die Eigenart des philosophischen Erkennens gegenüber dem "vorwissenschaftlichen Erkennen" ab. Dabei führt er den Terminus "naives vorwissenschaftliches Erkennen" ein, was keine Wertung beinhaltet, sondern lediglich meint, dass es sich dabei um eine Art der Wahrnehmung handelt, die nicht vom Thema der Kenntnisnahme erfüllt ist, die geschieht, ohne dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, es erfolgt wie nebenbei, und ist somit unsystematisch und unkritisch. (Etwa wenn eine Köchin feststellt: Das Wasser kocht.) Eine weitere Unterart des vorwissenschaftlichen Erkennens ist das theoretische vorwissenschaftliche Erkennen, welches nicht den Gegenstand selbst sprechen lässt, sondern ihn durch Erfahrungen, Beobachtungen, Überlegungen und Schlüsse zu erfassen sucht. Diese Form hat wiederum zwei Modi, nämlich den organischen und den anorganischen Typus. Die Präliminarien sind umständlich, braucht es aber, um das folgende Zitat richtig einordnen und verstehen zu können:
>>Das Anorganische dieses theoretischen Erkennens liegt auf der Hand. Es knüpft nicht an das naive Kenntnisnehmen an, sondern es setzt sich souverän darüber hinweg.
Es geht nur ganz von "außen" und ohne jeden unmittelbaren Sachkontakt an das Seiende heran. Bei dieser Art theoretischen außerwissenschaftlichen und außerphilosophischen Erkennens wird der naive Sachkontakt entweder bewußt ausgeschaltet, was fälschlich für spezifisch kritisch gehalten wird, oder der naive Sachkontakt wird unvermerkt ignoriert; immer geht man von allgemeinen, scheinbar evidenten Tatbeständen aus und deduziert aus ihnen.
Jemand argumentiert etwa: Alle sittlichen Werte sind relativ; denn verschiedene Völker und Zeiten halten jeweils entgegengesetzte Haltungen für gut und schlecht. Hier wird mit völliger Ignorierung des im naiven Sachkontakt vorliegenden Aspektes der Werte von außen her, aus einer Prämisse, die man von anderen ohne tieferes Verstehen dieses eigentlichen Tatbestandes übernommen, in völlig unkritischer Weise gefolgert. Denn die Verschiedenheit vieler Ansichten über gut und bös präjudiziert ja an sich noch nichts in bezug auf die Relativität der Werte. Oder jemand argumentiert: Alle Werte sind relativ; denn wir können doch nicht mehr erkennen, als was uns so erscheint; in dem wir es erkennen, ist es doch immer auf unser subjektives Erkenntnisvermögen relativ. Hier wird eine einer falschen Philosophie entstammende Scheinselbstverständlichkeit kritiklos als Prämisse zugrundegelegt, und man hält sich dabei für besonders kritisch, weil man sich über den im naiven Sachkontakt vorliegenden Aspekt erhebt. Daß man im nächsten Augenblick über das sittliche Verhalten eines Menschen empört ist und damit den sittlichen Wert als etwas Objektives behandelt, wird entweder gar nicht bemerkt oder nicht als etwas empfunden, was uns stutzig zu machen braucht. Denn dieser Typus hält prinzipiell sein theoretisches Erkennen, das sich aus nicht stringenten Schlüssen, aus ungeprüften Prämissen ergibt, für viel vertrauenswürdiger als das naive Kenntnisnehmen.
In diesem anorganischen theoretischen vorwissenschaftlichen Erkennen ist die Heimat alles Dilettantismus, aller Scheinselbstverständlichkeit, aller "Kurzschlüsse", alles fadenscheinigen rationalistischen Theoretisierens. Hier wirkt sich die mangelnde Kritik in prinzipiell verhängnisvollerer Weise aus als beim naiven Kenntnisnehmen und selbst als beim organischen theoretischen Erkennen. Denn hier wird ein Geistesregister gezogen, dessen Bedeutung mit dem Grad echter Kritik steht und fällt. <<
Aus: Dietrich von Hildebrand: Der Sinn philosophischen Fragens und Erkennens.
ElsaLaska - 17. Aug, 21:11


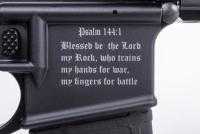

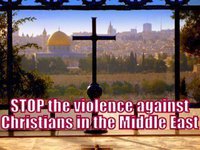
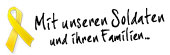
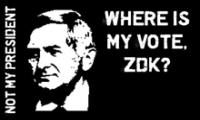
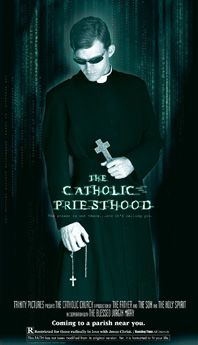


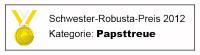
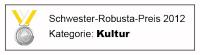
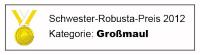
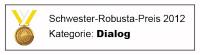
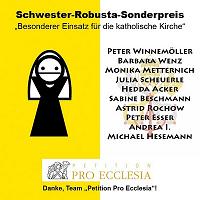
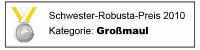
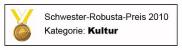
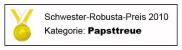
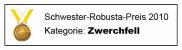

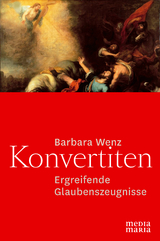
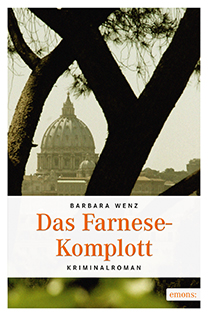




Ein weiteres Merkmal ist, daß er unbelehrbar uneinsichtig bzgl. seiner grundsätzlichen Irrtümer ist, und immer bestrebt, den Naiven in seiner akademisch elaborierten Borniertheit im Namen der Aufklärung zu verunsichern und wahre Denker mundtot zu machen.
Ich wünschte, W. v. Humboldt wäre bei seiner ursprünglichen Einsicht geblieben, daß die Belange der Bildung nicht in die Zuständigkeit des Staates gehörten, es kam anders, aber wahr ist's immer noch.