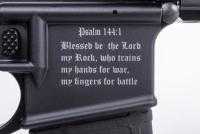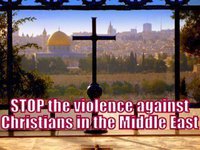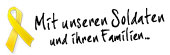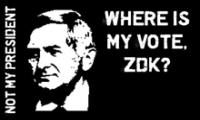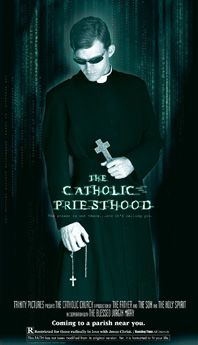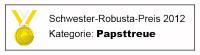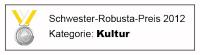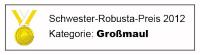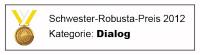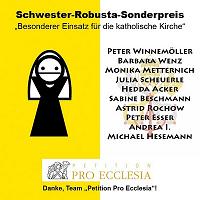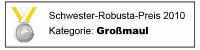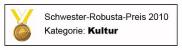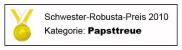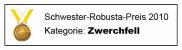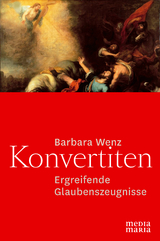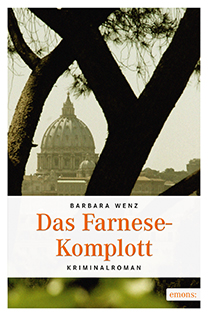WilderKaiser - 25. Aug, 14:41
Gut. Konsequent weitergedacht, würde das Teile der Geisteswissenschaften wegfegen. Aber wieso auch nicht. Wer braucht schon fünhundert Regalmeter Kafka-Deutungen. In der Philosophie sieht es ja ähnlich schlimm aus. Man kommt einfach nicht mehr weg von diesem behäbigen, musealen Touch. LG, WilderKaiser
ElsaLaska - 25. Aug, 16:15
Das verstehe ich jetzt nicht. Die Geisteswissenschaften haben noch nie den Anspruch erhoben, die Kunst ersetzen zu wollen oder Kunst zu sein.
WilderKaiser - 26. Aug, 01:06
Ja, zugegeben, das mag ja sein. Aber ich hatte schon sehr oft den Eindruck, dass sich die Produzenten sekundärer Texte dem Künstler im Verständnis seines Werks überlegen fühlten; das wurde auch mir gegenüber so geäußert. Und dann wurde mir klar, dass alles, was Interpretation herausforderte, eigentlich nicht auf dem Seziertisch der Geisteswissenschaften landen sollte. Die wissenschaftliche Herangehensweise vermisst das Kunstwerk und zerlegt es in seine Einzelteile, ohne es danach wieder zusammensetzen zu können, es sei denn, als frankensteinartiges Gebilde. Nein, mich stört ja nicht einmal das - aber es gibt eindeutig einen Überhang des Sekundären, und ganz am Grund dieser Wortpyramide liegt das ursprüngliche Werk; auch George Steiner spricht davon, ironischerweise in einem Buch mit dem deutschen Titel: "Von realer Gegenwart. Hat unser Sprechen Inhalt?" Ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie wir etwas ausdrücken, auch etwas über unser Verhältnis zur Realität aussagt. Und insofern glaube ich, dass die Realität ganz einfach verschwindet. Was könnte realistischer sein als ein Gedicht von Georg Trakl, auch wenn es nicht mit dem Alltagsverstand zu begreifen ist? Künstlerische Veranlagung bedeutet eben auch, sich zur Kunst hingezogen zu fühlen. Nüchtern betrachtet, dürfte der im Beitrag beschriebene Typus eher die Regel als die Ausnahme sein. Erfolg, der sich nicht an Verkaufszahlen, sondern an Wirkmächtigkeit orientiert, rückt sowieso immer mehr in den Hintergrund. LG, WilderKaiser