Gut, dann eine Würdigung Teresa von Avilas
aus romanistischer Sicht ...
"Als besonders paradox anmutendes und dennoch typisches Opfer jener seit Jahrhunderten funktionierenden Verdrängungsleistung [nämlich dass das spanische Kulturleben im 16. und 17. Jh. eigentlich von "conversos" getragen wurde] enthüllt sich der heutigen Forschung zunehmend das literarische Werk der spanischen Nationalheiligen und Kirchenlehrerin Teresa von Avila (1515-1582); nach und nach ersteht diese selbst als eine der herausragenden Frauengestalten der europäischen Geschichte und [...] eine der ganz wenigen mit den Wissenssystemen ihrer Zeit vertrauten Schriftstellerinnen, die ihre Souveränität (zumindest eine Zeitlang) gegen die Arroganz männlicher Herrschaftsautorität zu behaupten vermochten. Verschwiegen wurde nämlich nicht nur, dass diese Identifikationsfigur hispanischer Weiblichkeit selbst dem jüdischen Bürgertum Toledos, das sich durch Konversion der Exilierung entzogen hatte, entstammte und folglich maßgeblich von dessen, inzwischen spiritualistisch gewendeter Kultur der "inneren Emigration" geprägt wurde, sondern ebenso, dass ihre Genese als Schriftstellerin aufgrund dieser Herkunft unweigerlich nur über tiefgreifende psychische und religiöse Konflikte vonstatten gehen konnte. [...]
Seit ihrer Heiligsprechung im Jahre 1622 wurde die eigentlich leicht als strategische List zu durchschauende, simulierte Naivität ihrer Sprache als Zeichen weiblicher Unbildung missverstanden und die Vehemenz ihrer ekstatischen Rhetorik zur Idylle verklärt, was es andererseits der vorwissenschaftlichen Neurosenlehre des frühen 19. Jhs. erleichterte, die extrem poetischen Erfahrungsfiguren in diesem Werk zu pathologischen Artikulationen weiblicher Hysterie zu verfälschen. [!!!]
[...]
Dem Wagnis ihrer Überschreitung der durch dogmatische Diskurse, durch Sprach- und Imaginationsverbote gezogenen Grenzen verdankt sich desgleichen auch in ihren übrigen Werken jene metaästhetische Illuminationserfahrung, die sich Jahrhunderte später in den Lichtkonzepten der radikalsten poetischen Neuerer der Moderne: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Breton, usw. wiederfinden wird. Indem sich Teresas poetische Subjektivität über ihre Liebes-Meditation Zutritt verschafft zu den archaischen Territorien des biblischen Orients, die zu betreten ihr als Frau und Nachfahrin von Sepharden verwehrt ist, erobert sie sich jene metadiskursiven Paradiese zurück, die den Ursprungsort jeglicher Kunst anzeigen. Es ist an der Zeit, sich der von der Geschichte verschütteten Wege zu dieser Illumination neu zu versichern."
André Stoll: Die poetischen Paradiese des Ichs. Teresa von Avilas "Von der Liebe Gottes". Beltz Athenäum, 1994. Auszüge aus dem Vorwort.
"Als besonders paradox anmutendes und dennoch typisches Opfer jener seit Jahrhunderten funktionierenden Verdrängungsleistung [nämlich dass das spanische Kulturleben im 16. und 17. Jh. eigentlich von "conversos" getragen wurde] enthüllt sich der heutigen Forschung zunehmend das literarische Werk der spanischen Nationalheiligen und Kirchenlehrerin Teresa von Avila (1515-1582); nach und nach ersteht diese selbst als eine der herausragenden Frauengestalten der europäischen Geschichte und [...] eine der ganz wenigen mit den Wissenssystemen ihrer Zeit vertrauten Schriftstellerinnen, die ihre Souveränität (zumindest eine Zeitlang) gegen die Arroganz männlicher Herrschaftsautorität zu behaupten vermochten. Verschwiegen wurde nämlich nicht nur, dass diese Identifikationsfigur hispanischer Weiblichkeit selbst dem jüdischen Bürgertum Toledos, das sich durch Konversion der Exilierung entzogen hatte, entstammte und folglich maßgeblich von dessen, inzwischen spiritualistisch gewendeter Kultur der "inneren Emigration" geprägt wurde, sondern ebenso, dass ihre Genese als Schriftstellerin aufgrund dieser Herkunft unweigerlich nur über tiefgreifende psychische und religiöse Konflikte vonstatten gehen konnte. [...]
Seit ihrer Heiligsprechung im Jahre 1622 wurde die eigentlich leicht als strategische List zu durchschauende, simulierte Naivität ihrer Sprache als Zeichen weiblicher Unbildung missverstanden und die Vehemenz ihrer ekstatischen Rhetorik zur Idylle verklärt, was es andererseits der vorwissenschaftlichen Neurosenlehre des frühen 19. Jhs. erleichterte, die extrem poetischen Erfahrungsfiguren in diesem Werk zu pathologischen Artikulationen weiblicher Hysterie zu verfälschen. [!!!]
[...]
Dem Wagnis ihrer Überschreitung der durch dogmatische Diskurse, durch Sprach- und Imaginationsverbote gezogenen Grenzen verdankt sich desgleichen auch in ihren übrigen Werken jene metaästhetische Illuminationserfahrung, die sich Jahrhunderte später in den Lichtkonzepten der radikalsten poetischen Neuerer der Moderne: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Breton, usw. wiederfinden wird. Indem sich Teresas poetische Subjektivität über ihre Liebes-Meditation Zutritt verschafft zu den archaischen Territorien des biblischen Orients, die zu betreten ihr als Frau und Nachfahrin von Sepharden verwehrt ist, erobert sie sich jene metadiskursiven Paradiese zurück, die den Ursprungsort jeglicher Kunst anzeigen. Es ist an der Zeit, sich der von der Geschichte verschütteten Wege zu dieser Illumination neu zu versichern."
André Stoll: Die poetischen Paradiese des Ichs. Teresa von Avilas "Von der Liebe Gottes". Beltz Athenäum, 1994. Auszüge aus dem Vorwort.
ElsaLaska - 11. Sep, 22:32


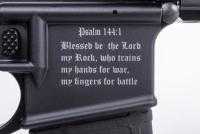

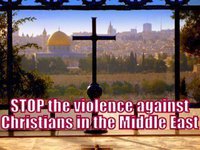
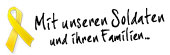
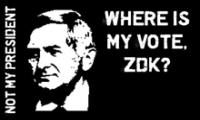
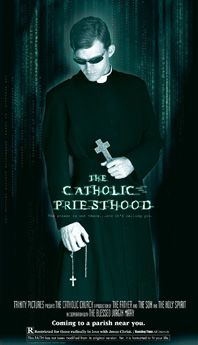


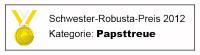
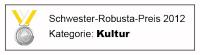
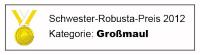
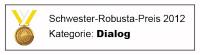
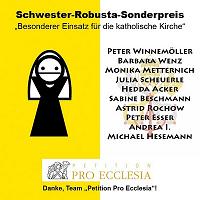
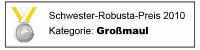
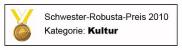
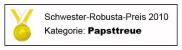
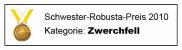

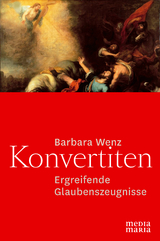
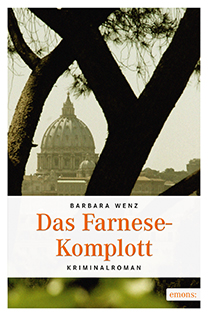




Doch, das ist nun mal ein äusserst illuminierter Satz! Da hat die Theresa etwas zum Staunen und zum Nachdenken! Es wird ihr vielleicht die Ewigkeit ein wenig verkürzen.