Leo 13 und Elena Guerra
In meiner Rubrik "Geistliche Paare" des Vatican-Magazins hatte ich tatsächlich auch einmal über Leo XIII. und Elena Guerra geschrieben.
Ich dachte, es wäre ein guter Zeitpunkt, diesen Artikel wieder aus der Schublade zu holen. Eigentlich ist er recht pfingstlich, und Pfingsten ist schon seit geraumer Zeit vorbei - aber Pfingsten kann man gar nicht oft genug haben ...
>>
Nichts weniger als den Eintritt der gesamten Weltkirche in das "universale Obergemach" hat diese ansonsten äußerst bescheidene Ordensfrau, die sich selbst als ein armes Dienstmädchen, als eine Gepäckträgerin für den Heiligen Geist bezeichnet, in einem ihrer Schreiben an ihren Zeitgenossen, Papst Leo XIII., gefordert. Gemeint hat sie den Abendmahlssaal, in dem sich einst Maria mit den Zwölfen versammelte, um im Gebet zu verharren, bis sie das Brausen des vom Vater gesandten Heiligen Geistes vernahmen, der sie in Verzückung geraten ließ. Eine wahrhaft pfingstliche Frau also, derer wir im Pfingstmonat Mai an dieser Stelle gedenken.
In Rom ist es fast immer schön, aber ganz besonders schön ist das Pfingstfest, weil am Sonntag nach der Messe die römischen Feuerwehrleute säckeweise Blütenblätter von roten Rosen durch den Oculus, die Öffnung der Kuppel über die im Pantheon versammelten Gläubigen herunterwerfen, um an die zumeist vernachlässigte Person der Trinität, den Heiligen Geist, zu erinnern, der "wie Feuerzungen" herabgekommen sei. Elena Guerra hat bei ihrem Rombesuch im Jahre 1870 dieses Spektakel wohl nicht miterlebt, denn diese herrliche, jahrhundertealte Tradition wurde erst Mitte der neunziger Jahre durch Monsignore Antonio Tedesco wiederbelebt.
Zum Zeitpunkt ihres ersten Rombesuches ist Elena bereits 35 Jahre alt und hat zwar schon viel Leid erfahren, sich aber bereits einen Namen gemacht als Katechetin, hochtalentierte Schriftstellerin und Verfasserin frommer Broschüren und Zeitschriften, so dass sie den Beinamen "die goldene Feder" trägt. Für die Schülerinnen an dem 1882 von ihr gegründeten Institut der heiligen Zita, zu denen übrigens auch Gemma Galgani zählte, verfasst sie Grammatiklehrbücher und Schulbücher über die römische und italienische Geschichte. Dass sie selbst einmal in die Kirchengeschichte eingehen wird mit ihren insgesamt zehn Briefen an Papst Leo XIII., damit hatte sie wohl selbst nicht gerechnet.
Denn Elena achtete sich selbst für gering und notierte im Alter von zwanzig Jahren in ihrem Tagebuch: "Ich bin eine kleine Frau, mein Äußeres hat nichts besonders Gefälliges, das Gesicht ist ganz gewöhnlich."
Am 23. Juni 1835 im toskanischen Lucca geboren, wurde sie noch am selben Tag getauft. Ihre Begeisterung für Papst und Kirche ist eine stetig brennende Flamme. Aus Liebe zur Liturgie und den Kirchenvätern hat sie sich mit dem Studium der lateinischen Sprache befasst, und auch eine schwere Krankheit, die sie gut acht Jahre lang ans Bett fesselt, kann diesen genialischen Schaffensgeist nicht bremsen.
Auf dem Papstthron sitzt Pius IX., das Erste Vatikanische Konzil ist im Schwange und wird im selben Jahr noch das so genannte Unfehlbarkeitsdogma verkünden. Elena begegnet ihm auf ihrer Romreise persönlich, genau wie dem heiligen Don Bosco, und dieser Papst wird sie auch in ihrer Mission bestärken. Doch es ist sein Nachfolger im Vatikan, Vincenzo Gioacchino Pecci mit Taufnamen, der von 1878 bis 1903 als Leo XIII. die katholische Kirche führen wird, der ihr sehnsüchtigstes Anliegen "ein neues Pfingsten" für alle Christgläubigen auszurufen, fördern und aktiv unterstützen wird.
Doch woher stammte diese Eingebung, diese spezielle Einfühlung und Vorliebe für den Heiligen Geist?
Sie beschreibt es in ihren eigenen Worten einmal so: "Die Verehrung des Heiligen Geistes war immer ziemlich glühend in meinem Herzen, obwohl sie mir niemand empfohlen hatte, obwohl ich keine Lektüre kannte, die sie mich hätte lieben gelehrt." Schon als kleines Mädchen erfüllte sie jedes Mal eine große Freude, wenn sie aus Anlass der Pfingstnovene in der Kirche war, die auch immer sehr feierlich gestaltet wurde. Später habe sie oft große Traurigkeit darüber empfunden, dass "diese wichtigste unter allen Andachten" so in Vergessenheit geraten ist. Sie belässt es aber nicht bei den traurigen Empfindungen, sondern wird selbst als geistbeflügelte Missionarin tätig, indem sie bereit im Jahre 1865 ein Faltblatt mit Gebeten zur dritten göttlichen Person sowie eines mit "Übungen für die Novene und für das Fest des Heiligen Geistes" herausgibt. Ein Jahr später folgt eine Broschüre zur Vorbereitung auf das Hochfest Pfingsten, dem der Erzbischof verschiedene Ablässe zugefügt hat. Doch all dies erscheint ihr kümmerlich, wenn sie nicht den Papst, das Oberhaupt der Weltkirche, in ihrem Anliegen gewinnen kann. Der Gedanke, ihn anzuschreiben, keimt bereits in ihr auf. Elena wartet ab, demütig, geduldig und im Gebet, auf den richtigen Zeitpunkt, um dieses Unterfangen zu wagen. Dreißig Jahre später hat sie das Gefühl, in dieser Sache nicht viel mehr bewegen zu können, nichts mehr anderes für den Heiligen Geist tun zu können, als die Schrift "Der neue Abendmahlssaal" zu verfassen und in Druck zu geben. Zu diesem Zeitpunkt ist Elena fünfundfünfzig Jahre alt. Dass sie sich in der Annahme geirrt hat, nichts mehr anderes tun zu können wird schnell klar. Im Jahr 1894 wird das Büchlein dem Papst übergeben, dieser nimmt es wohlwollend auf und gibt sein Segen. Leo XIII. ist ein Papst, der die Zeichen der Zeit erkennt und bereit ist, gegenzusteuern, auch und gerade dadurch, dass er die Kirche, gegen Ende des 19. Jahrhunderts abgehängt und in Isolation gegenüber den gesellschaftspolitischen Entwicklungen, aus ihrer Starre und Abschottung herausführt. Während seiner Amtszeit veröffentlicht er 86 Enzykliken, davon im Jahre 1891 eine über den Zustand der arbeitenden Klasse: Rerum novarum, ein vielbeachtetes Schreiben und die erste umfassende Enzyklika zur katholischen Soziallehre.
Sowohl Elena wie auch der Papst sind schmerzlich beunruhigt über die Wirrungen und Irrungen ihrer Zeit: Die Ausbreitung des Modernismus, der antiklerikalen und antipäpstlichen Strömungen, des Materialismus und des Positivismus. Aus der Aposelgeschichte ist bekannt, dass die Erneuerung des Antlitzes der Erde mit der Ausschüttung des Heiligen Geistes im "Obergemach" seinen Ausgang nahm. Somit ist es für Elena dringend notwendig, dass die Kirche für die Aufgabe ihrer wandelnden und heilenden Erneuerung sich wieder im Abendmahlssaal versammeln muss. So schreibt sie voller Sorge ihren ersten Brief am 17. April 1895 in dem sie, nach den einführenden höflich-demütigen Floskeln, in ausgesprochen klaren Worten den Zustand der Welt beschreibt: "Heiliger Vater, die Welt ist böse, der Geist Satans triumphiert in der verkommenen Gesellschaft und in einer Vielzahl von Seelen, die er dem Herzen Gottes entreißt." Weiter beklagt sie, dass so viele Andachten zur Behebung der Not empfohlen werden, doch über die erste und wichtigste dazu herrsche Schweigen. Elena appelliert an seine päpstliche Sorge und sein Gewissen als oberster Hirte, wenn Sie dann schreibt, dass nur er imstande sie, die Christen wieder zum Heiligen Geist zurückzuführen, der die Herrschaft des Teufels zerstört und die ersehnte Erneuerung der Erde gewährleistet.
Der Papst antwortet ihr nicht direkt, aber er veröffentlicht das Breve "Provida Matris Charitate - Über den Heiligen Geist", in dem er am Ende seiner Ausführungen zum Pfingstereignis die Novene zum Heiligen Geist allen Gläubigen ans Herz legt durch besondere Indulgenzen.
In einem dritten Brief vom 1. Dezember 1895 bezieht sich Elena auf die leoninische Enzyklika über die Freimaurerei in Italien aus dem Oktober des selben Jahres. Elena möchte ihn in diesem Schreiben anflehen, dass er die Gläubigen zu einem einmütigen und weltweiten Gebet zum Heiligen Geist sammle: "Das solle gleichsam ein neues geistliches Obergemach sein, von dem aus jeden Tag umso mehr inbrünstige Gebete um das Gute zum Himmel steigen, je mehr das Böse der Freimauerei die Erde überflutet." Ein einmalige Pfingstnovene im Ablauf des liturgischen Jahres sei entschieden zu wenig, sondern es gehe darum, dass daraus ein allgemeines und ununterbrochenes Gebet enstehe. Auch in ihrem vierten Brief, den sie fast ein Jahr später abschickt, wiederholt sie, dass eine Novene nicht ausreiche, sondern vielmehr ein "ständiges Neues universales Obergemach" eingerichtet werden müsse, das "wahre Haus der Anbetung. Der Heilige Vater möchte sich beeilen, die Gläubigen in dieses Neue Obergemach zu rufen. Kaum zehn Tage später schreibt sie erneut und diesmal formuliert sie ein visionäres Anliegen, nämlich, dass das Gebet "Komm herab, Heiliger Geist", die selbe Verbreitung und Beliebtheit erlangen möge unter Katholiken wie das Ave Maria. Es besteht keinerlei Zweifel, dass die ebenso demütigen wie kühnen Worte von Schwester Elena, von prophetischer Kraft erfüllt, bei Papst Leo XIII. auf fruchtbaren geistigen Nährboden fallen und in kurzer Zeit zur maßgeblichen Enzyklika über die Wertschätzung des Heiligen Geistes und seiner Gaben heranreifen - Divinum illud munus -, die am 9. Mai 1897 zur Veröffentlichung kommt. Zu Recht weist der Heilige Vater gleich zu Beginn darauf hin, dass es im Glauben wie im Kult nicht dazu kommen dürfe, die drei Personen der heiligen Trinität zu verwechseln oder voneinander zu trennen, denn dies sei "nicht katolisch". Sodann erläutert er die Bedeutung des Wirkens des Heiligen Geistes für die Empfängnis Jesu, in der Kirche, bei der Erlösung des Menschen und zum Ende der Zeiten. Er bespricht Wirkung und Gegenwart, Gaben und Früchte und erläutert unsere Pflichten gegenüber dem Heiligen Geist, bevor mit einem neuerlichen Hinweis auf die Pfingstnovene der Schutz und Segen Mariens erbeten wird. Eine kontemplative Lektüre - oder auch erneute Lektüre - dieser Enzyklika sei allen Lesern dieser Rubrik zur Vorbereitung auf das Pfingstfest gerne empfohlen.
Wie fruchtbar das gemeinsame Wirken von Elena Guerra und Leo XIII. vor gut 120 Jahren war, können wir daran ersehen, dass sich um das Jahr 2005 weltweit etwa 80 Millionen Katholiken in charismatischen Gebetsgruppen und Gemeinschaften engagierten, in Deutschland selbst waren es schon damals etwa 11.000 Christen; weil 2005 auch das Gründungsjahr des Gebetshauses Augsburg von Jutta und Johannes Hartl ist, werden es inzwischen noch ein paar Tausend mehr Gläubige sein. Und so wirkt der Heilige Geist stets als Vollender: des Heilswirken Jesu nach seiner Himmelfahrt, in unserem persönlichen Schalten und Walten und wohl höchstwahrscheinlich auch bei der geistlichen Teamarbeit zur größeren Ehre seiner göttlichen Person durch Elena Guerra und Leo XIII.
Ich dachte, es wäre ein guter Zeitpunkt, diesen Artikel wieder aus der Schublade zu holen. Eigentlich ist er recht pfingstlich, und Pfingsten ist schon seit geraumer Zeit vorbei - aber Pfingsten kann man gar nicht oft genug haben ...
>>
Nichts weniger als den Eintritt der gesamten Weltkirche in das "universale Obergemach" hat diese ansonsten äußerst bescheidene Ordensfrau, die sich selbst als ein armes Dienstmädchen, als eine Gepäckträgerin für den Heiligen Geist bezeichnet, in einem ihrer Schreiben an ihren Zeitgenossen, Papst Leo XIII., gefordert. Gemeint hat sie den Abendmahlssaal, in dem sich einst Maria mit den Zwölfen versammelte, um im Gebet zu verharren, bis sie das Brausen des vom Vater gesandten Heiligen Geistes vernahmen, der sie in Verzückung geraten ließ. Eine wahrhaft pfingstliche Frau also, derer wir im Pfingstmonat Mai an dieser Stelle gedenken.
In Rom ist es fast immer schön, aber ganz besonders schön ist das Pfingstfest, weil am Sonntag nach der Messe die römischen Feuerwehrleute säckeweise Blütenblätter von roten Rosen durch den Oculus, die Öffnung der Kuppel über die im Pantheon versammelten Gläubigen herunterwerfen, um an die zumeist vernachlässigte Person der Trinität, den Heiligen Geist, zu erinnern, der "wie Feuerzungen" herabgekommen sei. Elena Guerra hat bei ihrem Rombesuch im Jahre 1870 dieses Spektakel wohl nicht miterlebt, denn diese herrliche, jahrhundertealte Tradition wurde erst Mitte der neunziger Jahre durch Monsignore Antonio Tedesco wiederbelebt.
Zum Zeitpunkt ihres ersten Rombesuches ist Elena bereits 35 Jahre alt und hat zwar schon viel Leid erfahren, sich aber bereits einen Namen gemacht als Katechetin, hochtalentierte Schriftstellerin und Verfasserin frommer Broschüren und Zeitschriften, so dass sie den Beinamen "die goldene Feder" trägt. Für die Schülerinnen an dem 1882 von ihr gegründeten Institut der heiligen Zita, zu denen übrigens auch Gemma Galgani zählte, verfasst sie Grammatiklehrbücher und Schulbücher über die römische und italienische Geschichte. Dass sie selbst einmal in die Kirchengeschichte eingehen wird mit ihren insgesamt zehn Briefen an Papst Leo XIII., damit hatte sie wohl selbst nicht gerechnet.
Denn Elena achtete sich selbst für gering und notierte im Alter von zwanzig Jahren in ihrem Tagebuch: "Ich bin eine kleine Frau, mein Äußeres hat nichts besonders Gefälliges, das Gesicht ist ganz gewöhnlich."
Am 23. Juni 1835 im toskanischen Lucca geboren, wurde sie noch am selben Tag getauft. Ihre Begeisterung für Papst und Kirche ist eine stetig brennende Flamme. Aus Liebe zur Liturgie und den Kirchenvätern hat sie sich mit dem Studium der lateinischen Sprache befasst, und auch eine schwere Krankheit, die sie gut acht Jahre lang ans Bett fesselt, kann diesen genialischen Schaffensgeist nicht bremsen.
Auf dem Papstthron sitzt Pius IX., das Erste Vatikanische Konzil ist im Schwange und wird im selben Jahr noch das so genannte Unfehlbarkeitsdogma verkünden. Elena begegnet ihm auf ihrer Romreise persönlich, genau wie dem heiligen Don Bosco, und dieser Papst wird sie auch in ihrer Mission bestärken. Doch es ist sein Nachfolger im Vatikan, Vincenzo Gioacchino Pecci mit Taufnamen, der von 1878 bis 1903 als Leo XIII. die katholische Kirche führen wird, der ihr sehnsüchtigstes Anliegen "ein neues Pfingsten" für alle Christgläubigen auszurufen, fördern und aktiv unterstützen wird.
Doch woher stammte diese Eingebung, diese spezielle Einfühlung und Vorliebe für den Heiligen Geist?
Sie beschreibt es in ihren eigenen Worten einmal so: "Die Verehrung des Heiligen Geistes war immer ziemlich glühend in meinem Herzen, obwohl sie mir niemand empfohlen hatte, obwohl ich keine Lektüre kannte, die sie mich hätte lieben gelehrt." Schon als kleines Mädchen erfüllte sie jedes Mal eine große Freude, wenn sie aus Anlass der Pfingstnovene in der Kirche war, die auch immer sehr feierlich gestaltet wurde. Später habe sie oft große Traurigkeit darüber empfunden, dass "diese wichtigste unter allen Andachten" so in Vergessenheit geraten ist. Sie belässt es aber nicht bei den traurigen Empfindungen, sondern wird selbst als geistbeflügelte Missionarin tätig, indem sie bereit im Jahre 1865 ein Faltblatt mit Gebeten zur dritten göttlichen Person sowie eines mit "Übungen für die Novene und für das Fest des Heiligen Geistes" herausgibt. Ein Jahr später folgt eine Broschüre zur Vorbereitung auf das Hochfest Pfingsten, dem der Erzbischof verschiedene Ablässe zugefügt hat. Doch all dies erscheint ihr kümmerlich, wenn sie nicht den Papst, das Oberhaupt der Weltkirche, in ihrem Anliegen gewinnen kann. Der Gedanke, ihn anzuschreiben, keimt bereits in ihr auf. Elena wartet ab, demütig, geduldig und im Gebet, auf den richtigen Zeitpunkt, um dieses Unterfangen zu wagen. Dreißig Jahre später hat sie das Gefühl, in dieser Sache nicht viel mehr bewegen zu können, nichts mehr anderes für den Heiligen Geist tun zu können, als die Schrift "Der neue Abendmahlssaal" zu verfassen und in Druck zu geben. Zu diesem Zeitpunkt ist Elena fünfundfünfzig Jahre alt. Dass sie sich in der Annahme geirrt hat, nichts mehr anderes tun zu können wird schnell klar. Im Jahr 1894 wird das Büchlein dem Papst übergeben, dieser nimmt es wohlwollend auf und gibt sein Segen. Leo XIII. ist ein Papst, der die Zeichen der Zeit erkennt und bereit ist, gegenzusteuern, auch und gerade dadurch, dass er die Kirche, gegen Ende des 19. Jahrhunderts abgehängt und in Isolation gegenüber den gesellschaftspolitischen Entwicklungen, aus ihrer Starre und Abschottung herausführt. Während seiner Amtszeit veröffentlicht er 86 Enzykliken, davon im Jahre 1891 eine über den Zustand der arbeitenden Klasse: Rerum novarum, ein vielbeachtetes Schreiben und die erste umfassende Enzyklika zur katholischen Soziallehre.
Sowohl Elena wie auch der Papst sind schmerzlich beunruhigt über die Wirrungen und Irrungen ihrer Zeit: Die Ausbreitung des Modernismus, der antiklerikalen und antipäpstlichen Strömungen, des Materialismus und des Positivismus. Aus der Aposelgeschichte ist bekannt, dass die Erneuerung des Antlitzes der Erde mit der Ausschüttung des Heiligen Geistes im "Obergemach" seinen Ausgang nahm. Somit ist es für Elena dringend notwendig, dass die Kirche für die Aufgabe ihrer wandelnden und heilenden Erneuerung sich wieder im Abendmahlssaal versammeln muss. So schreibt sie voller Sorge ihren ersten Brief am 17. April 1895 in dem sie, nach den einführenden höflich-demütigen Floskeln, in ausgesprochen klaren Worten den Zustand der Welt beschreibt: "Heiliger Vater, die Welt ist böse, der Geist Satans triumphiert in der verkommenen Gesellschaft und in einer Vielzahl von Seelen, die er dem Herzen Gottes entreißt." Weiter beklagt sie, dass so viele Andachten zur Behebung der Not empfohlen werden, doch über die erste und wichtigste dazu herrsche Schweigen. Elena appelliert an seine päpstliche Sorge und sein Gewissen als oberster Hirte, wenn Sie dann schreibt, dass nur er imstande sie, die Christen wieder zum Heiligen Geist zurückzuführen, der die Herrschaft des Teufels zerstört und die ersehnte Erneuerung der Erde gewährleistet.
Der Papst antwortet ihr nicht direkt, aber er veröffentlicht das Breve "Provida Matris Charitate - Über den Heiligen Geist", in dem er am Ende seiner Ausführungen zum Pfingstereignis die Novene zum Heiligen Geist allen Gläubigen ans Herz legt durch besondere Indulgenzen.
In einem dritten Brief vom 1. Dezember 1895 bezieht sich Elena auf die leoninische Enzyklika über die Freimaurerei in Italien aus dem Oktober des selben Jahres. Elena möchte ihn in diesem Schreiben anflehen, dass er die Gläubigen zu einem einmütigen und weltweiten Gebet zum Heiligen Geist sammle: "Das solle gleichsam ein neues geistliches Obergemach sein, von dem aus jeden Tag umso mehr inbrünstige Gebete um das Gute zum Himmel steigen, je mehr das Böse der Freimauerei die Erde überflutet." Ein einmalige Pfingstnovene im Ablauf des liturgischen Jahres sei entschieden zu wenig, sondern es gehe darum, dass daraus ein allgemeines und ununterbrochenes Gebet enstehe. Auch in ihrem vierten Brief, den sie fast ein Jahr später abschickt, wiederholt sie, dass eine Novene nicht ausreiche, sondern vielmehr ein "ständiges Neues universales Obergemach" eingerichtet werden müsse, das "wahre Haus der Anbetung. Der Heilige Vater möchte sich beeilen, die Gläubigen in dieses Neue Obergemach zu rufen. Kaum zehn Tage später schreibt sie erneut und diesmal formuliert sie ein visionäres Anliegen, nämlich, dass das Gebet "Komm herab, Heiliger Geist", die selbe Verbreitung und Beliebtheit erlangen möge unter Katholiken wie das Ave Maria. Es besteht keinerlei Zweifel, dass die ebenso demütigen wie kühnen Worte von Schwester Elena, von prophetischer Kraft erfüllt, bei Papst Leo XIII. auf fruchtbaren geistigen Nährboden fallen und in kurzer Zeit zur maßgeblichen Enzyklika über die Wertschätzung des Heiligen Geistes und seiner Gaben heranreifen - Divinum illud munus -, die am 9. Mai 1897 zur Veröffentlichung kommt. Zu Recht weist der Heilige Vater gleich zu Beginn darauf hin, dass es im Glauben wie im Kult nicht dazu kommen dürfe, die drei Personen der heiligen Trinität zu verwechseln oder voneinander zu trennen, denn dies sei "nicht katolisch". Sodann erläutert er die Bedeutung des Wirkens des Heiligen Geistes für die Empfängnis Jesu, in der Kirche, bei der Erlösung des Menschen und zum Ende der Zeiten. Er bespricht Wirkung und Gegenwart, Gaben und Früchte und erläutert unsere Pflichten gegenüber dem Heiligen Geist, bevor mit einem neuerlichen Hinweis auf die Pfingstnovene der Schutz und Segen Mariens erbeten wird. Eine kontemplative Lektüre - oder auch erneute Lektüre - dieser Enzyklika sei allen Lesern dieser Rubrik zur Vorbereitung auf das Pfingstfest gerne empfohlen.
Wie fruchtbar das gemeinsame Wirken von Elena Guerra und Leo XIII. vor gut 120 Jahren war, können wir daran ersehen, dass sich um das Jahr 2005 weltweit etwa 80 Millionen Katholiken in charismatischen Gebetsgruppen und Gemeinschaften engagierten, in Deutschland selbst waren es schon damals etwa 11.000 Christen; weil 2005 auch das Gründungsjahr des Gebetshauses Augsburg von Jutta und Johannes Hartl ist, werden es inzwischen noch ein paar Tausend mehr Gläubige sein. Und so wirkt der Heilige Geist stets als Vollender: des Heilswirken Jesu nach seiner Himmelfahrt, in unserem persönlichen Schalten und Walten und wohl höchstwahrscheinlich auch bei der geistlichen Teamarbeit zur größeren Ehre seiner göttlichen Person durch Elena Guerra und Leo XIII.
ElsaLaska - 1. Jul, 09:05


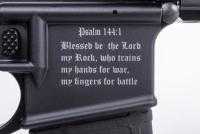

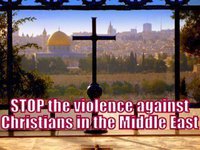
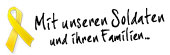
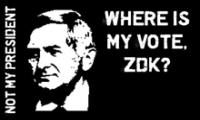
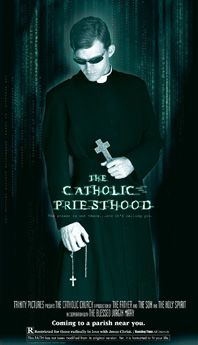


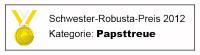
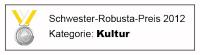
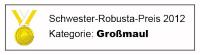
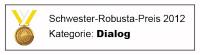
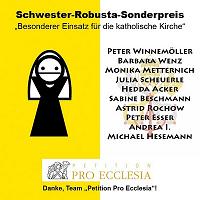
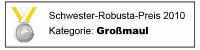
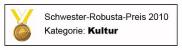
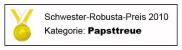
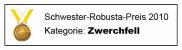

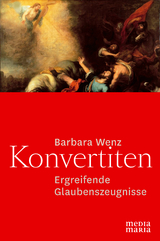
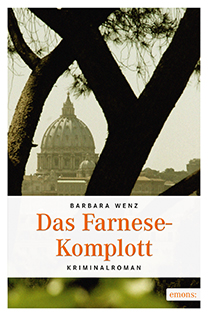




Trackback URL:
https://elsalaska.twoday.net/stories/1022707326/modTrackback