Mann-Frau-Miteinander-Kirchesein
Mein Artikel im Vatican-Magazin Januar 2012.
Von Barbara Wenz.
Hello, again, ich sag’ nur hello again ... Knapp einen Monat nach dem Besuch Benedikts XVI. in Deutschland hatte uns bereits der graue kirchenpolitische Alltag wieder – in Form des Positionspapieres des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) mit dem Titel „Partnerschaftlich Kirche sein!“ und der Forderung nach dem Diakonat für die Frau, verfasst am 15. Oktober 2011. In diesem Licht betrachtet besaß das Predigtwort des Papstes im Olympiastadion Berlin am 22. September nicht nur konstatierenden, sondern direkt vorausweisenden Charakter: Manchen erscheine die Kirche nur mehr als eine der vielen Organisationen in einer demokratischen Gesellschaft, nach deren Maßstäben und Gesetzen sie auch zu behandeln sei. Dann käme auch keine Freude mehr auf, vielmehr verbreiteten sich Unzufriedenheit und Missvergnügen, weil man die eigenen oberflächlichen und fehlerhaften Vorstellungen, die eigenen ‚Kirchenträume’ nicht verwirklicht sehe.
Das Papier des KDFB bezieht sich auf einen Antrag der ZdK vom April 2011 und insbesondere auf das Hirtenwort der deutschen Bischöfe „Zur Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft“ aus dem Jahre 1981. Darin setzen sich die deutschen Oberhirten dafür ein, dass „die Kirche zu einem Modell für das gleichwertige und partnerschaftliche Zusammenleben und –wirken von Männern und Frauen“ wird.
Man könnte dieser Aussage glatt entnehmen, dass dies seit fast 2000 Jahren komplett misslungen sei? Wie wäre es denn einmal mit der positiven Darstellung dessen, was Männer und Frauen in der Kirche seit ihrem Anbeginn längst umbrochen, revolutioniert und grundstürzend eingebracht haben, durch ihr glutvolles, Funken sprühendes Zusammenleben und Zusammenwirken?
„Kirche“ ohne Artikel, das scheint ein Laden zu sein, der trist vor sich hin monothematisiert. KDFB, kfd, ZdK, BDKJ und noch mehr possierliche Kürzelbünde konstatieren auf ökologisch unbedenklichem grauen Papier, dass es an buntem, offenem Miteinander, Gleichberechtigung, Mitgestaltungsmöglichkeiten fehle. Sie beschlussfassen, verabschieden, fordern, gesprächsprozessieren. Zum Zölibat, zum Kommunionempfang für wiederverheirate Geschiedene, zur Frauenweihe. Da wird vulgärtheologisch gelaubsägt, populistisch gehämmert, selbstmitleidig gebatikt, dreist geflickschustert. Selbstverständlich Kirche sein lautet das Motto, selbstverständlich Mehrheit statt göttliche Wahrheit: Ja eben, in der Tat „Demokratisch Amen!“, wie es anlässlich der Freiburger Vigil quer in Brusthöhe auf dem Shirt einer katholischen Jugendfunktionärin zu lesen stand. Vermutlich an dieser prominenten Stelle, damit der ihr gegenüberstehende Papst es auch ohne Lesebrille gefälligst entziffern möge.
Die Agenda vom partnerschaftlichen Miteinander in „Kirche 2011“ scheint sich jedenfalls vor allem darin zu erschöpfen, dass manche Männer ein Amt haben und alle Frauen auch eines wollen und bekommen sollen.
Was genau soll an dieser Forderung nun „partnerschaftlich“ sein? Sie klingt ungefähr so aufregend, geisterfüllt und inspiriert wie ein Artikel aus der Rodong Singmun, der nordkoreanischen Arbeiterzeitung.
Dabei hat die Kirche in ihrer zweitausendjährigen Geschichte ebenso poetisch-glutvolle wie effektive geistliche und geistsprühende Paare hervorgebracht, die dem Lauf der Kirchengeschichte auf Gott hin einen je neuen Kernspin beigebracht haben: Franziskus und Klara, Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz, Franz von Sales und Johanna Franziska von Chantal, Hieronymus und Paula von Rom, Benedikt und Scholastika, ungezählte heilige Ehepaare und noch viele mehr, von denen wir heute nichts mehr wissen, weil sie keine berühmten Namen trugen.
Zumeist wird das viel zitierte Wort des Paulus im Zusammenhang mit der Forderung nach „moderner“ Partnerschaftlichkeit vulgo „Frauenweihe jetzt!“ angeführt: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau.“ (Gal 3,28). Unbequemere Passagen aus den Paulus-Briefen werden dagegen historisch-kritisch als spätere Hinzufügungen eines fremden Autoren deklariert, um das Gesamtbild wieder für die kirchenpolitische Agenda passend zurechtzuschneiden.
Doch um das Pauluswort von der Einheit der Geschlechter in Christo richtig zu erfassen, genügt ein Blick unter das Kreuz am Karfreitag. Der Herr und Erlöser hat nämlich nicht nur Seine heilige Kirche eingesetzt, er hat sogar noch in seiner Todesstunde den Männern und Frauen darin eine Weisung für die Zukunft mitgegeben, die wegen der Schlichtheit ihrer Worte vielleicht zu selten in ihrer tiefen und universalen Bedeutung verstanden wird. Jesus Christus selbst war Beziehung – zu Gott seinem Vater, zu seinen Jüngern und Aposteln, die er ermahnt hat, wie Brüder untereinander zu sein (Matthäus 12, 46-50).
Ein einziges Mal hat er eine Beziehung zwischen zwei Personen gestiftet, als er Maria unterm Kreuz anspricht:„Frau, siehe dein Sohn!“ Und zum Lieblingsjünger gewandt, sagt: „Siehe, deine Mutter!“ (Johannes 19, 26-27). Diese beiden Anrufe, die uns das Johannesevangelium überliefert hat, zählen zu den Sieben Letzten Worten Jesu am Kreuz, denen von alters her eine tiefe geistige Bedeutung zugemessen wurde.
Häufig wird diese Stelle so ausgelegt, dass Jesus seine Mutter Maria nach seinem Tode nicht als nunmehr kinderlose Witwe ohne männlichen Beistand zurücklassen wollte, eine Situation, welche die damalige Gesellschaft als prekär betrachtete. Da Er sonst nichts besaß auf Erden – Seine Kleider waren bereits an die Soldaten verteilt worden – kann man diese Stelle als eine Art Verfügung zur materiellen Versorgung für diejenigen Hinterbliebenen auffassen, die Ihm besonders nahe standen. Selbstverständlich hat sie auch einen theologischen, vor allem mariologischen Gehalt, der in jüngster Zeit von Johannes-Paul II. in seiner Enzyklika Redemptoris mater und der damaligen Kommentierung von Joseph Kardinal Ratzinger herausgestellt worden ist: Maria als Mutter aller Gläubigen und Mutter der Kirche.
Auf einer weiteren Ebene könnte man Maria und Johannes unterm Kreuz auch als Prototyp sehen, als erstes Modell für all die erfolgreichen geistlichen Paare, ob nun als Heilige anerkannt oder nicht, welche die Kirche im Laufe der folgenden Jahrhunderte noch hervorbringen sollte: Mann und Frau einander zugetan in einer geläuterten Form von Liebe, erlöst von Begierden und Egoismen. Seite an Seite und Schulter an Schulter stehend im gemeinsamen Blick auf das Kreuz, das Ostergeheimnis des Erlösers, um so, durch ihre innige Gemeinschaft zur Verherrlichung Seines mystischen Leibes, der Kirche, beizutragen.
Der katholische Philosoph Dietrich von Hildebrand aus der phänomenologischen Schule Edmund Husserls vertiefte sich in seinem Schaffen insbesondere in das Mysterium der Liebe und der menschlichen Gemeinschaft. Dabei hat er nicht nur eine wunderbare Schrift über die Ehe vorgelegt, sondern es auch unternommen, den Geist der caritas in Kategorien wie bräutliche Liebe, eheliche Liebe, Geschwisterliebe usw. zu unterteilen. Das, was er „freundschaftliche Liebe“ nennt, dürfte dem, was sich etwa zwischen einem Franziskus und einer Klara abgespielt hat, am nächsten kommen: „Zwei Personen stehen gleichsam ‚schräg nebeneinander’, wie in einem Halbkreis, so dass sich ihre Schulter, d. h. die rechte Schulter des einen und die linke Schulter des anderen, berühren. In dieser Haltung können sie sich einander zuwenden und gleichzeitig weit vor sich hin blicken, ohne ihre Position zu verändern. Die Personen verbleiben beim Erleben der Freundesliebe prinzipiell auf ihrem eigenen Boden, aber durch tiefes Sich-Verstehen vereint, bauen sie aufeinander und treffen sich in bestimmten Wertbereichen ... Die Freundesliebe kann zur heiligen Liebe in Christus werden.“ (S. T. Zarzycki: Spiritualität des Herzens. Die philosophisch-theologischen Grundlagen bei Dietrich von Hildebrand.)
Es ist ein wundervolles Bild, das von Hildebrand hier zeichnet. Trifft es nicht, geistlich gesprochen, auch auf Johannes und Maria unterm Kreuz stehend zu und die heilige Liebe, die sie in Christus vereinte?
Mit dem Pfingstwunder über vierzig Tage später konnte noch niemand rechnen, mit der Auferstehung Jesu am Sonntag nach der Kreuzigung schon gar nicht. Die Apostel und Jünger waren geflohen, hatten sich zerstreut, versteckt. Petrus hatte den Herrn drei Mal verleugnet, Judas Ischariot sich erhängt. Und der unschuldige Sohn Gottes hing wie die jämmerlichste und verdammenswerteste aller Kreaturen zwischen zwei Verbrechern nackt und blutüberströmt am Kreuz. Obwohl Er unmenschliche Ängste und Qualen durchlitten haben, selbst so randvoll mit Schmerz gewesen sein muss, fällt sein liebender Blick auf diese beiden Menschen: Maria, die Ihn – nicht nur für die neun Monate ihrer Schwangerschaft - immer unter ihrem Herzen trug und Johannes, der an Seiner Seite lag beim Letzten Abendmahl.
Hier stehen nicht ein Mann und eine Frau, die verzweifelt sind, weil eine großartige neue Bewegung mitsamt ihrem Gründer gescheitert ist, sondern ein Mann und eine Frau, die Gott mit all ihrer Kraft lieben und den Menschensohn wie sich selbst. Diese beiden werden den irrsinnigen Mut aufbringen, in den Tagen, die da noch kommen sollen, Schulter an Schulter gewendet und dabei gleichzeitig weit vor sich hin blickend, die verstreute Herde zu sammeln und zu einen. Sie tun dies, so möchte es der Erlöser der Welt, in ihren weiblichen und männlichen Eigenschaften: als Mutter und als Sohn – eine Beziehung, die wie keine andere, wenn sie gelingt, von lauterster Freundschaft und fürsorgender Liebe zwischen Mann und Frau geprägt ist.
Nein, das ist nicht nur aus reiner Sorge um die soziale Stellung der beiden geschehen, es hat einen spirituellen, geheimnisvollen Hintergrund. In den Jahrhunderten, die folgten, sollten sich, nach dem Muster von Maria und Johannes, ungezählte Männer und Frauen zusammen finden, im Blick auf das Kreuz, nicht nur in einem „partnerschaftlichen Miteinander“, sondern in tief empfundener Freundschaft und sublimer Liebe, die ihre gegenseitige persönliche Beziehung erlöst, transzendiert, überhöht und geistlich fruchtbar machen wird.
Das soll nicht heißen, dass sie keine Versuchungen hatten, dass ihre jeweilige Beziehung stets hehr und vollendet gewesen ist. Es soll heißen, dass sie es geschafft haben, trotz aller Anfechtungen, die irdische Liebe nun einmal so mit sich bringt, den Frieden und das Staunen über Gott, der die Liebe ist, durch ihre innige Gemeinschaft nach außen zu strahlen, ja der ganzen Kirche zum Geschenk zu machen.
Wie heißt es im Schluss des Schreibens der römischen Glaubenskongregation an die katholischen Bischöfe zur Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt:„Die Kirche weiß um die Macht der Sünde, die in den Einzelnen und in den Gesellschaftssystemen am Werk ist und manchmal dazu führen könnte, die Hoffnung auf das Gutsein von Mann und Frau zu verlieren. Aber auf Grund ihres Glaubens an den gekreuzigten und auferstandenen Christus weiß sie noch mehr um die Kraft der Vergebung und der Hingabe trotz aller Wunden und Ungerechtigkeiten. Der Friede und das Staunen, auf die sie die Männer und Frauen von heute mit Vertrauen hinweist, sind der Friede und das Staunen, die im Garten der Auferstehung unsere Welt und die ganze Geschichte erleuchtet haben mit der Offenbarung: ‚Gott ist die Liebe’ (1 Joh 4, 8-16).“
Unterzeichnet wurde dieses verständnisinnige, fast lyrisch anmutende Dokument, dessen Lektüre sich in Gänze lohnt, im Jahre 2004 von Kardinal Ratzinger und Erzbischof Amato.
Partnerschaftlich Kirche sein – das ist doch längst eine von Gott gewollte Erfolgsgeschichte, die bereits vor fast zweitausend Jahren an einem Karfreitag begonnen hat – eben nicht auf der Grundlage von Amt und Weihe, sondern auf dem Fundament von Liebe und Beziehung im gemeinsamen Blick auf den Erlöser am Kreuz und Seine Auferstehung.
Von Barbara Wenz.
Hello, again, ich sag’ nur hello again ... Knapp einen Monat nach dem Besuch Benedikts XVI. in Deutschland hatte uns bereits der graue kirchenpolitische Alltag wieder – in Form des Positionspapieres des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) mit dem Titel „Partnerschaftlich Kirche sein!“ und der Forderung nach dem Diakonat für die Frau, verfasst am 15. Oktober 2011. In diesem Licht betrachtet besaß das Predigtwort des Papstes im Olympiastadion Berlin am 22. September nicht nur konstatierenden, sondern direkt vorausweisenden Charakter: Manchen erscheine die Kirche nur mehr als eine der vielen Organisationen in einer demokratischen Gesellschaft, nach deren Maßstäben und Gesetzen sie auch zu behandeln sei. Dann käme auch keine Freude mehr auf, vielmehr verbreiteten sich Unzufriedenheit und Missvergnügen, weil man die eigenen oberflächlichen und fehlerhaften Vorstellungen, die eigenen ‚Kirchenträume’ nicht verwirklicht sehe.
Das Papier des KDFB bezieht sich auf einen Antrag der ZdK vom April 2011 und insbesondere auf das Hirtenwort der deutschen Bischöfe „Zur Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft“ aus dem Jahre 1981. Darin setzen sich die deutschen Oberhirten dafür ein, dass „die Kirche zu einem Modell für das gleichwertige und partnerschaftliche Zusammenleben und –wirken von Männern und Frauen“ wird.
Man könnte dieser Aussage glatt entnehmen, dass dies seit fast 2000 Jahren komplett misslungen sei? Wie wäre es denn einmal mit der positiven Darstellung dessen, was Männer und Frauen in der Kirche seit ihrem Anbeginn längst umbrochen, revolutioniert und grundstürzend eingebracht haben, durch ihr glutvolles, Funken sprühendes Zusammenleben und Zusammenwirken?
„Kirche“ ohne Artikel, das scheint ein Laden zu sein, der trist vor sich hin monothematisiert. KDFB, kfd, ZdK, BDKJ und noch mehr possierliche Kürzelbünde konstatieren auf ökologisch unbedenklichem grauen Papier, dass es an buntem, offenem Miteinander, Gleichberechtigung, Mitgestaltungsmöglichkeiten fehle. Sie beschlussfassen, verabschieden, fordern, gesprächsprozessieren. Zum Zölibat, zum Kommunionempfang für wiederverheirate Geschiedene, zur Frauenweihe. Da wird vulgärtheologisch gelaubsägt, populistisch gehämmert, selbstmitleidig gebatikt, dreist geflickschustert. Selbstverständlich Kirche sein lautet das Motto, selbstverständlich Mehrheit statt göttliche Wahrheit: Ja eben, in der Tat „Demokratisch Amen!“, wie es anlässlich der Freiburger Vigil quer in Brusthöhe auf dem Shirt einer katholischen Jugendfunktionärin zu lesen stand. Vermutlich an dieser prominenten Stelle, damit der ihr gegenüberstehende Papst es auch ohne Lesebrille gefälligst entziffern möge.
Die Agenda vom partnerschaftlichen Miteinander in „Kirche 2011“ scheint sich jedenfalls vor allem darin zu erschöpfen, dass manche Männer ein Amt haben und alle Frauen auch eines wollen und bekommen sollen.
Was genau soll an dieser Forderung nun „partnerschaftlich“ sein? Sie klingt ungefähr so aufregend, geisterfüllt und inspiriert wie ein Artikel aus der Rodong Singmun, der nordkoreanischen Arbeiterzeitung.
Dabei hat die Kirche in ihrer zweitausendjährigen Geschichte ebenso poetisch-glutvolle wie effektive geistliche und geistsprühende Paare hervorgebracht, die dem Lauf der Kirchengeschichte auf Gott hin einen je neuen Kernspin beigebracht haben: Franziskus und Klara, Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz, Franz von Sales und Johanna Franziska von Chantal, Hieronymus und Paula von Rom, Benedikt und Scholastika, ungezählte heilige Ehepaare und noch viele mehr, von denen wir heute nichts mehr wissen, weil sie keine berühmten Namen trugen.
Zumeist wird das viel zitierte Wort des Paulus im Zusammenhang mit der Forderung nach „moderner“ Partnerschaftlichkeit vulgo „Frauenweihe jetzt!“ angeführt: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau.“ (Gal 3,28). Unbequemere Passagen aus den Paulus-Briefen werden dagegen historisch-kritisch als spätere Hinzufügungen eines fremden Autoren deklariert, um das Gesamtbild wieder für die kirchenpolitische Agenda passend zurechtzuschneiden.
Doch um das Pauluswort von der Einheit der Geschlechter in Christo richtig zu erfassen, genügt ein Blick unter das Kreuz am Karfreitag. Der Herr und Erlöser hat nämlich nicht nur Seine heilige Kirche eingesetzt, er hat sogar noch in seiner Todesstunde den Männern und Frauen darin eine Weisung für die Zukunft mitgegeben, die wegen der Schlichtheit ihrer Worte vielleicht zu selten in ihrer tiefen und universalen Bedeutung verstanden wird. Jesus Christus selbst war Beziehung – zu Gott seinem Vater, zu seinen Jüngern und Aposteln, die er ermahnt hat, wie Brüder untereinander zu sein (Matthäus 12, 46-50).
Ein einziges Mal hat er eine Beziehung zwischen zwei Personen gestiftet, als er Maria unterm Kreuz anspricht:„Frau, siehe dein Sohn!“ Und zum Lieblingsjünger gewandt, sagt: „Siehe, deine Mutter!“ (Johannes 19, 26-27). Diese beiden Anrufe, die uns das Johannesevangelium überliefert hat, zählen zu den Sieben Letzten Worten Jesu am Kreuz, denen von alters her eine tiefe geistige Bedeutung zugemessen wurde.
Häufig wird diese Stelle so ausgelegt, dass Jesus seine Mutter Maria nach seinem Tode nicht als nunmehr kinderlose Witwe ohne männlichen Beistand zurücklassen wollte, eine Situation, welche die damalige Gesellschaft als prekär betrachtete. Da Er sonst nichts besaß auf Erden – Seine Kleider waren bereits an die Soldaten verteilt worden – kann man diese Stelle als eine Art Verfügung zur materiellen Versorgung für diejenigen Hinterbliebenen auffassen, die Ihm besonders nahe standen. Selbstverständlich hat sie auch einen theologischen, vor allem mariologischen Gehalt, der in jüngster Zeit von Johannes-Paul II. in seiner Enzyklika Redemptoris mater und der damaligen Kommentierung von Joseph Kardinal Ratzinger herausgestellt worden ist: Maria als Mutter aller Gläubigen und Mutter der Kirche.
Auf einer weiteren Ebene könnte man Maria und Johannes unterm Kreuz auch als Prototyp sehen, als erstes Modell für all die erfolgreichen geistlichen Paare, ob nun als Heilige anerkannt oder nicht, welche die Kirche im Laufe der folgenden Jahrhunderte noch hervorbringen sollte: Mann und Frau einander zugetan in einer geläuterten Form von Liebe, erlöst von Begierden und Egoismen. Seite an Seite und Schulter an Schulter stehend im gemeinsamen Blick auf das Kreuz, das Ostergeheimnis des Erlösers, um so, durch ihre innige Gemeinschaft zur Verherrlichung Seines mystischen Leibes, der Kirche, beizutragen.
Der katholische Philosoph Dietrich von Hildebrand aus der phänomenologischen Schule Edmund Husserls vertiefte sich in seinem Schaffen insbesondere in das Mysterium der Liebe und der menschlichen Gemeinschaft. Dabei hat er nicht nur eine wunderbare Schrift über die Ehe vorgelegt, sondern es auch unternommen, den Geist der caritas in Kategorien wie bräutliche Liebe, eheliche Liebe, Geschwisterliebe usw. zu unterteilen. Das, was er „freundschaftliche Liebe“ nennt, dürfte dem, was sich etwa zwischen einem Franziskus und einer Klara abgespielt hat, am nächsten kommen: „Zwei Personen stehen gleichsam ‚schräg nebeneinander’, wie in einem Halbkreis, so dass sich ihre Schulter, d. h. die rechte Schulter des einen und die linke Schulter des anderen, berühren. In dieser Haltung können sie sich einander zuwenden und gleichzeitig weit vor sich hin blicken, ohne ihre Position zu verändern. Die Personen verbleiben beim Erleben der Freundesliebe prinzipiell auf ihrem eigenen Boden, aber durch tiefes Sich-Verstehen vereint, bauen sie aufeinander und treffen sich in bestimmten Wertbereichen ... Die Freundesliebe kann zur heiligen Liebe in Christus werden.“ (S. T. Zarzycki: Spiritualität des Herzens. Die philosophisch-theologischen Grundlagen bei Dietrich von Hildebrand.)
Es ist ein wundervolles Bild, das von Hildebrand hier zeichnet. Trifft es nicht, geistlich gesprochen, auch auf Johannes und Maria unterm Kreuz stehend zu und die heilige Liebe, die sie in Christus vereinte?
Mit dem Pfingstwunder über vierzig Tage später konnte noch niemand rechnen, mit der Auferstehung Jesu am Sonntag nach der Kreuzigung schon gar nicht. Die Apostel und Jünger waren geflohen, hatten sich zerstreut, versteckt. Petrus hatte den Herrn drei Mal verleugnet, Judas Ischariot sich erhängt. Und der unschuldige Sohn Gottes hing wie die jämmerlichste und verdammenswerteste aller Kreaturen zwischen zwei Verbrechern nackt und blutüberströmt am Kreuz. Obwohl Er unmenschliche Ängste und Qualen durchlitten haben, selbst so randvoll mit Schmerz gewesen sein muss, fällt sein liebender Blick auf diese beiden Menschen: Maria, die Ihn – nicht nur für die neun Monate ihrer Schwangerschaft - immer unter ihrem Herzen trug und Johannes, der an Seiner Seite lag beim Letzten Abendmahl.
Hier stehen nicht ein Mann und eine Frau, die verzweifelt sind, weil eine großartige neue Bewegung mitsamt ihrem Gründer gescheitert ist, sondern ein Mann und eine Frau, die Gott mit all ihrer Kraft lieben und den Menschensohn wie sich selbst. Diese beiden werden den irrsinnigen Mut aufbringen, in den Tagen, die da noch kommen sollen, Schulter an Schulter gewendet und dabei gleichzeitig weit vor sich hin blickend, die verstreute Herde zu sammeln und zu einen. Sie tun dies, so möchte es der Erlöser der Welt, in ihren weiblichen und männlichen Eigenschaften: als Mutter und als Sohn – eine Beziehung, die wie keine andere, wenn sie gelingt, von lauterster Freundschaft und fürsorgender Liebe zwischen Mann und Frau geprägt ist.
Nein, das ist nicht nur aus reiner Sorge um die soziale Stellung der beiden geschehen, es hat einen spirituellen, geheimnisvollen Hintergrund. In den Jahrhunderten, die folgten, sollten sich, nach dem Muster von Maria und Johannes, ungezählte Männer und Frauen zusammen finden, im Blick auf das Kreuz, nicht nur in einem „partnerschaftlichen Miteinander“, sondern in tief empfundener Freundschaft und sublimer Liebe, die ihre gegenseitige persönliche Beziehung erlöst, transzendiert, überhöht und geistlich fruchtbar machen wird.
Das soll nicht heißen, dass sie keine Versuchungen hatten, dass ihre jeweilige Beziehung stets hehr und vollendet gewesen ist. Es soll heißen, dass sie es geschafft haben, trotz aller Anfechtungen, die irdische Liebe nun einmal so mit sich bringt, den Frieden und das Staunen über Gott, der die Liebe ist, durch ihre innige Gemeinschaft nach außen zu strahlen, ja der ganzen Kirche zum Geschenk zu machen.
Wie heißt es im Schluss des Schreibens der römischen Glaubenskongregation an die katholischen Bischöfe zur Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt:„Die Kirche weiß um die Macht der Sünde, die in den Einzelnen und in den Gesellschaftssystemen am Werk ist und manchmal dazu führen könnte, die Hoffnung auf das Gutsein von Mann und Frau zu verlieren. Aber auf Grund ihres Glaubens an den gekreuzigten und auferstandenen Christus weiß sie noch mehr um die Kraft der Vergebung und der Hingabe trotz aller Wunden und Ungerechtigkeiten. Der Friede und das Staunen, auf die sie die Männer und Frauen von heute mit Vertrauen hinweist, sind der Friede und das Staunen, die im Garten der Auferstehung unsere Welt und die ganze Geschichte erleuchtet haben mit der Offenbarung: ‚Gott ist die Liebe’ (1 Joh 4, 8-16).“
Unterzeichnet wurde dieses verständnisinnige, fast lyrisch anmutende Dokument, dessen Lektüre sich in Gänze lohnt, im Jahre 2004 von Kardinal Ratzinger und Erzbischof Amato.
Partnerschaftlich Kirche sein – das ist doch längst eine von Gott gewollte Erfolgsgeschichte, die bereits vor fast zweitausend Jahren an einem Karfreitag begonnen hat – eben nicht auf der Grundlage von Amt und Weihe, sondern auf dem Fundament von Liebe und Beziehung im gemeinsamen Blick auf den Erlöser am Kreuz und Seine Auferstehung.
ElsaLaska - 16. Mär, 10:38





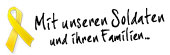
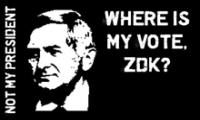










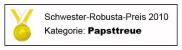








Danke
@Hedwig