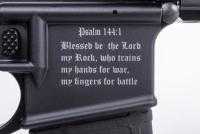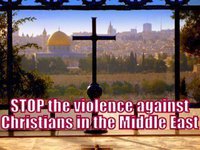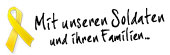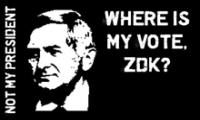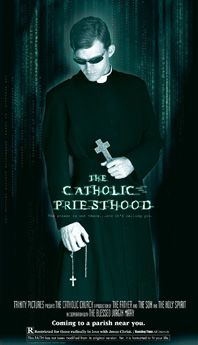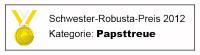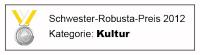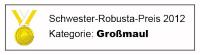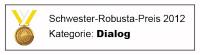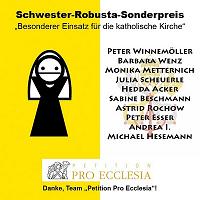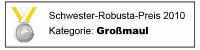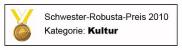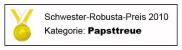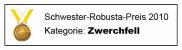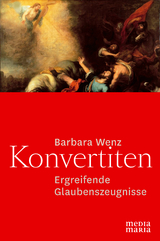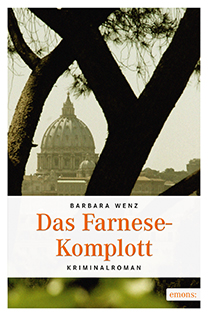Kant: Kritik der reinen Vernunft Tranzendentale Elementarlehre
[Mitschrift 1. Teil über die Einleitung Kants zu seiner Kritik der reinen Vernunft hier]
Transzendentale Ästhetik:
Alles Denken muss sich auf Anschauungen von Gegenständen mittels der Sinnlichkeit beziehen.
Die Materie eines Gegenstandes, also das, was in uns eine sinnliche Empfindung auslöst, ist a posteriori gegeben, die Form der Erscheinung müsste aber a priori in unserem Verstand gespeichert sein und sollte deshalb unter Ausschluss der Sinnlichkeit betrachtet werden können, als "reine Form", "reine Anschauung". [Schönen Gruß an Plato auch].
Kant erläutert: Wenn ich eine Vorstellung von einem Körper habe und davon Substanz, Kraft und Teilbarkeit ("Verstand") unterscheide von Undurchdringlichkeit, Härte, Farbe ("sinnlich", "empirisch") bleibt davon übrig Ausdehnung und Gestalt (reine sinnliche Anschauung, a priori). Wenn man die Sinnlichkeit isolierend immer weiter fortschreitet, gelangt man zu den zwei reinen Formen sinnlicher Anschauung als Prinzipien der Erkenntnis a priori gibt, nämlich den Raum und die Zeit.
1. Über den Raum (Metaphysische Erörterung)
1.1. Der Raum ist kein empirischer Begriff, denn die Vorstellung vom Raum muss schon zu Grunde liegen, damit ich überhaupt erkennen kann, dass ich mich an diesem, etwas anderes sich an jenem Ort befindet. Die Erfahrung von Raum selbst ist nur als gedacht möglich.
[Auf eine Weise falsch. Zuerst kommen sinnliche Erfahrungen: Dieser Bauklotz liegt weiter weg als der andere, ich muss mich stärker danach ausstrecken, wenn ich ihn erreichen will, aufstehen, oder gehen. So entwickelt sich ein Gefühl für den Raum durch empirische Erfahrung, im Umgang, im Sich-Bewegen innerhalb des Raumes]
1.2 Der Raum ist eine notwendige a priori Vorstellung, die äußeren Erscheinungen zugrundeliegt. Man kann sich zwar einen leeren Raum vorstellen, aber nicht, dass gar kein Raum sei.
[Das ist wirklich eine interessante Feststellung. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir ja auch dreidimensionale Wesen sind, und keine zweidimensionalen. Zweidimensionale Wesen wäre es sicher ein leichtes, sich keinen Raum vorzustellen. Sie würden in Flächen denken oder so etwas ...]
1. 3. Raum ist reine Anschauung. Er ist einzig, die Begriffe von vielerlei verschiedenen Räumen in ihrer Mannigfaltigkeit beruht lediglich auf Einschränkungen. Wörtliches Zitat, weil ich jetzt leider etwas blockiert bin: "Hieraus folgt, dass in Ansehung seiner [des Raumes] eine Anschauung a priori, die nicht empirisch ist, allen Begriffen von demselben zugrundeliegt."
[Mit den Begriffen ist es allerdings nicht ganz so klar. Die Leute tun immer so, wie was weiß ich bestechend und messerscharf das wäre ... Von wegen... Von wegen ...]
1.4 Der Raum wird als eine unendlich gegebene Größe vorgestellt. Kein BEGRIFF kann so gedacht werden, dass er unendlich mögliche Vorstellungen von sich in sich enthielte, deshalb ist die Vorstellung des unendlich gegebenen Raumes Anschauung a priori und nicht Begriff.
[Mmpf.]
2. Transzendentale Erörterung des Begriffs vom Raum
[Also jetzt doch Begriff? Och kinners ...]
Sehr glasklare Sprache wirklich ...
Die transzendentale Eröterung eines Begriffes ist nach Kant also (in sprachlich einmaliger Prägnanz*gg*) die Erklärung eines Begriffes als eines Prinzips aus dem die Möglichkeit anderer synthetischer Erkenntniss a priori eingesehen werden kann. Geometrie etwa ist die Wissenschaft, die die Eigenschaften des Raumes synthetisch und doch a priori bestimmt. Der Raum muss deshalb Anschauung sei, weil sich über einen bloßen Begriff keine Sätze folgern lassen, die über den Begriff hinausgehen (was ja in der Geometrie aber geschieht). Seine Anschauung muss vor aller Wahrnehmung - a priori - in uns angetroffen werden, weil die geometrischen Sätze notwendig sind und gar nicht empirisch bzw. aus der Erfahrung heraus getroffen werden können.
Sie ist bloße Anschauung im Subjekt selbst. Er stellt nicht eine Eigenschaft der Objekte dar oder ihrer Beziehungen untereinander. Er ist die subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, die uns allein äußere Anschauung erst ermöglicht. Die Form aller Erscheinungen muss bereits vor aller wirklicher Wahrnehmung, also a priori, im "Gemüt" [wenn man mal wüsste, was er mit Gemüt meint ... Geist, Seele, Verstand, Vernunft?] vorhanden sein.
Der Raum betrifft alle Dinge, die uns äußerlich erscheinen mögen, aber er ist nichts, was den Dingen selbst eigen wäre.
Jetzt kommt eine Zweispaltung: Wenn man vom Raum einerseits spricht als "Alle Dinge sind nebeneinander im Raum" gilt unter der Einschränkung, dass diese Dinge von uns sinnlich erfasst sind/wären/werden können, fpgt man die Bedingung hinzu, dass alle Gegenstände nebeneinander im Raums sind (er meint wohl, wenn man es allgemeingültig und notwendig aussagte und nicht als gegebene Situation), dann gilt die Regel allgemein und ohne Einschränkung. [Das finde ich merkwürdig verdreht, den Ansatz. 5 plus 7 =12 mag ja eine allgemeingültige Aussage sein, die notwendig und richtig ist, aber es liegt auf der Hand, wenn ich zu fünf Äpfeln sieben dazugebe und nur lange genug warte, bis ein angesteckter völlig verfault, dann sind es eben nachher nur noch 11. Genausogut wie ich sagen kann: Alle Dinge sind nebeneinander im Raum" als wissenschaftliche Tatsache über das, was ich in der Welt vorfinde, kann ich das freilich auch nur über die Unordnung auf meinem Schreibtisch sagen. Gut, aber er hat schon Recht, ich finde seine Gedankengänge nur unnötig verschraubt, die Begrifflichkeiten nur mühselig dechiffrierbar.
Das eine bezöge sich als auf den realen Raum, das andere auf den idealen Raum.
[Schön. Hier sind die Ideen als nicht mehr ewig, sondern halt einfach subjektiv. Ich werde noch dahinterkommen, was daran jetzt so durchschlagend sein soll]
Und weil ich faul bin also der Schlusssatz des Kapitels als wortwörtliches Zitat:
"Dagegen ist der transzendentale Begriff der Erscheinungen im Raume eine kritische Erinnerung, daß überhaupt nichts, was im Raume angeschaut wird, eine Sache an sich, noch daß der Raum eine Form der Dinge sei, die ihnen etwa an sich selbst eigen wäre, sondern daß uns die Gegenstände an sich gar nicht bekannt sind, und, was wir äußere Gegenstände nennen, nichts anderes als bloße Vorstellungen unserer Sinnlichkeit sind, deren Form der Raum ist, deren wahres Korrelatum aber, d. i. das Ding an sich selbst, dadurch gar nicht erkannt wird, noch erkannt werden kann, nach welchem aber auch in der Erfahrung niemals gefragt wird."
Transzendentale Ästhetik:
Alles Denken muss sich auf Anschauungen von Gegenständen mittels der Sinnlichkeit beziehen.
Die Materie eines Gegenstandes, also das, was in uns eine sinnliche Empfindung auslöst, ist a posteriori gegeben, die Form der Erscheinung müsste aber a priori in unserem Verstand gespeichert sein und sollte deshalb unter Ausschluss der Sinnlichkeit betrachtet werden können, als "reine Form", "reine Anschauung". [Schönen Gruß an Plato auch].
Kant erläutert: Wenn ich eine Vorstellung von einem Körper habe und davon Substanz, Kraft und Teilbarkeit ("Verstand") unterscheide von Undurchdringlichkeit, Härte, Farbe ("sinnlich", "empirisch") bleibt davon übrig Ausdehnung und Gestalt (reine sinnliche Anschauung, a priori). Wenn man die Sinnlichkeit isolierend immer weiter fortschreitet, gelangt man zu den zwei reinen Formen sinnlicher Anschauung als Prinzipien der Erkenntnis a priori gibt, nämlich den Raum und die Zeit.
1. Über den Raum (Metaphysische Erörterung)
1.1. Der Raum ist kein empirischer Begriff, denn die Vorstellung vom Raum muss schon zu Grunde liegen, damit ich überhaupt erkennen kann, dass ich mich an diesem, etwas anderes sich an jenem Ort befindet. Die Erfahrung von Raum selbst ist nur als gedacht möglich.
[Auf eine Weise falsch. Zuerst kommen sinnliche Erfahrungen: Dieser Bauklotz liegt weiter weg als der andere, ich muss mich stärker danach ausstrecken, wenn ich ihn erreichen will, aufstehen, oder gehen. So entwickelt sich ein Gefühl für den Raum durch empirische Erfahrung, im Umgang, im Sich-Bewegen innerhalb des Raumes]
1.2 Der Raum ist eine notwendige a priori Vorstellung, die äußeren Erscheinungen zugrundeliegt. Man kann sich zwar einen leeren Raum vorstellen, aber nicht, dass gar kein Raum sei.
[Das ist wirklich eine interessante Feststellung. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir ja auch dreidimensionale Wesen sind, und keine zweidimensionalen. Zweidimensionale Wesen wäre es sicher ein leichtes, sich keinen Raum vorzustellen. Sie würden in Flächen denken oder so etwas ...]
1. 3. Raum ist reine Anschauung. Er ist einzig, die Begriffe von vielerlei verschiedenen Räumen in ihrer Mannigfaltigkeit beruht lediglich auf Einschränkungen. Wörtliches Zitat, weil ich jetzt leider etwas blockiert bin: "Hieraus folgt, dass in Ansehung seiner [des Raumes] eine Anschauung a priori, die nicht empirisch ist, allen Begriffen von demselben zugrundeliegt."
[Mit den Begriffen ist es allerdings nicht ganz so klar. Die Leute tun immer so, wie was weiß ich bestechend und messerscharf das wäre ... Von wegen... Von wegen ...]
1.4 Der Raum wird als eine unendlich gegebene Größe vorgestellt. Kein BEGRIFF kann so gedacht werden, dass er unendlich mögliche Vorstellungen von sich in sich enthielte, deshalb ist die Vorstellung des unendlich gegebenen Raumes Anschauung a priori und nicht Begriff.
[Mmpf.]
2. Transzendentale Erörterung des Begriffs vom Raum
[Also jetzt doch Begriff? Och kinners ...]
Sehr glasklare Sprache wirklich ...
Die transzendentale Eröterung eines Begriffes ist nach Kant also (in sprachlich einmaliger Prägnanz*gg*) die Erklärung eines Begriffes als eines Prinzips aus dem die Möglichkeit anderer synthetischer Erkenntniss a priori eingesehen werden kann. Geometrie etwa ist die Wissenschaft, die die Eigenschaften des Raumes synthetisch und doch a priori bestimmt. Der Raum muss deshalb Anschauung sei, weil sich über einen bloßen Begriff keine Sätze folgern lassen, die über den Begriff hinausgehen (was ja in der Geometrie aber geschieht). Seine Anschauung muss vor aller Wahrnehmung - a priori - in uns angetroffen werden, weil die geometrischen Sätze notwendig sind und gar nicht empirisch bzw. aus der Erfahrung heraus getroffen werden können.
Sie ist bloße Anschauung im Subjekt selbst. Er stellt nicht eine Eigenschaft der Objekte dar oder ihrer Beziehungen untereinander. Er ist die subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, die uns allein äußere Anschauung erst ermöglicht. Die Form aller Erscheinungen muss bereits vor aller wirklicher Wahrnehmung, also a priori, im "Gemüt" [wenn man mal wüsste, was er mit Gemüt meint ... Geist, Seele, Verstand, Vernunft?] vorhanden sein.
Der Raum betrifft alle Dinge, die uns äußerlich erscheinen mögen, aber er ist nichts, was den Dingen selbst eigen wäre.
Jetzt kommt eine Zweispaltung: Wenn man vom Raum einerseits spricht als "Alle Dinge sind nebeneinander im Raum" gilt unter der Einschränkung, dass diese Dinge von uns sinnlich erfasst sind/wären/werden können, fpgt man die Bedingung hinzu, dass alle Gegenstände nebeneinander im Raums sind (er meint wohl, wenn man es allgemeingültig und notwendig aussagte und nicht als gegebene Situation), dann gilt die Regel allgemein und ohne Einschränkung. [Das finde ich merkwürdig verdreht, den Ansatz. 5 plus 7 =12 mag ja eine allgemeingültige Aussage sein, die notwendig und richtig ist, aber es liegt auf der Hand, wenn ich zu fünf Äpfeln sieben dazugebe und nur lange genug warte, bis ein angesteckter völlig verfault, dann sind es eben nachher nur noch 11. Genausogut wie ich sagen kann: Alle Dinge sind nebeneinander im Raum" als wissenschaftliche Tatsache über das, was ich in der Welt vorfinde, kann ich das freilich auch nur über die Unordnung auf meinem Schreibtisch sagen. Gut, aber er hat schon Recht, ich finde seine Gedankengänge nur unnötig verschraubt, die Begrifflichkeiten nur mühselig dechiffrierbar.
Das eine bezöge sich als auf den realen Raum, das andere auf den idealen Raum.
[Schön. Hier sind die Ideen als nicht mehr ewig, sondern halt einfach subjektiv. Ich werde noch dahinterkommen, was daran jetzt so durchschlagend sein soll]
Und weil ich faul bin also der Schlusssatz des Kapitels als wortwörtliches Zitat:
"Dagegen ist der transzendentale Begriff der Erscheinungen im Raume eine kritische Erinnerung, daß überhaupt nichts, was im Raume angeschaut wird, eine Sache an sich, noch daß der Raum eine Form der Dinge sei, die ihnen etwa an sich selbst eigen wäre, sondern daß uns die Gegenstände an sich gar nicht bekannt sind, und, was wir äußere Gegenstände nennen, nichts anderes als bloße Vorstellungen unserer Sinnlichkeit sind, deren Form der Raum ist, deren wahres Korrelatum aber, d. i. das Ding an sich selbst, dadurch gar nicht erkannt wird, noch erkannt werden kann, nach welchem aber auch in der Erfahrung niemals gefragt wird."
ElsaLaska - 20. Nov, 16:33