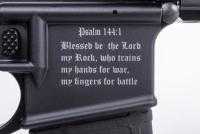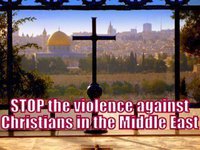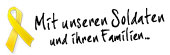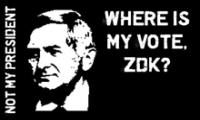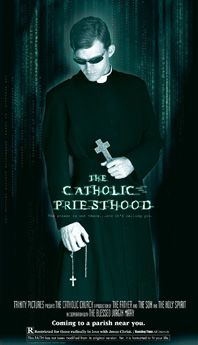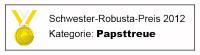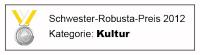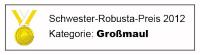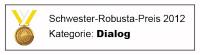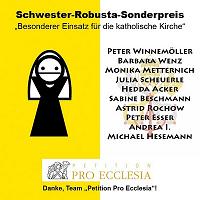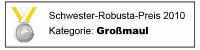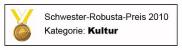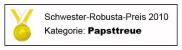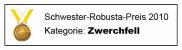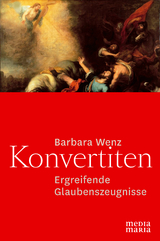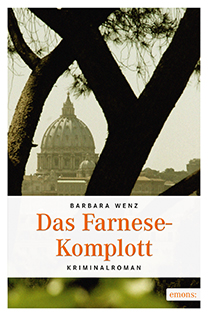Im Historischen Museum in Speyer läuft zur Zeit eine Ausstellung über Hexen.
Die
FAZ.net hat dazu einen Artikel gebracht - haben sie Spee wieder nicht erwähnt oder hab ich es überlesen? Egal.
Zum Thema passt gut ein Kommentar von Joseph Bordat von neulich, den ich einmal mit seiner Erlaubnis und leicht gekürzt nach oben holen wollte.
Joseph Bordat betreibt das
Weblog jobo72 und beschäftigt sich insbesondere mit christlicher Existenzphilosophie.
Hier sein sehr guter Kommentar:
>>Die Katholische Kirche habe im Mittelalter Millionen von Frauen in Europa als Hexen verbrannt. Sagt man. Ist aber in vierfacher Hinsicht schief.
1.) Der Schwerpunkt der Hexenverfolgung lag nicht in Europa, sondern liegt im heutigen Afrika. Dort hat sie alles andere als „christliche“ Gründe und wird von der Kirche durch die Arbeit der Missionare zu verhindern versucht.
2.) Die meisten Hexenverbrennungen gab es in Europa nicht im Mittelalter, sondern in der Frühen Neuzeit; die letzte Hexe wurde in Deutschland 1775 verbrannt. Dass man nach 1555, spätestens nach 1648 nicht der Katholischen Kirche allein die Verantwortung für die verstärkte Hexenverfolgung in Mittel- und Nordeuropa geben kann, dürfte jedem klar sein, der in Geschichte aufgepasst hat (cuius regio, eius religio). Und noch etwas: Im katholischen Spanien hat es keine Hexenverfolgung gegeben – wegen der Inquisition.
3.) Die Opfer waren nur in Deutschland mehrheitlich Frauen, sonst war das Verhältnis mindestens ausgeglichen, z. T. waren die Männer in der Mehrzahl; in Island waren 90%, in Estland 60% der Opfer Männer. 4.) Es waren nicht „Millionen“, sondern ca. 50.000 Opfer, rund die Hälfte davon im Gebiet des HRRDN. Wenn man davon ausgeht (und davon darf man wohl ausgehen), dass die Opfer zahlenmäßig zwischen protestantischen und katholischen Gebieten des Reichs ungleich verteilt waren – zu Lasten der protestantischen Gebiete –, dann hat die Katholische Kirche die Verantwortung für etwa 10.000 Todesopfer.
50.000 Opfer, in 350 Jahren europäischer Hexenverfolgung (1430-1780). Seit einigen Jahrzehnten werden Jahr für Jahr mindestens doppelt so viele Menschen ermordet, weil sie Christen sind, als in 350 Jahren ermordet wurden, weil man sie für Hexen oder Zauberer hielt. Ich will nicht aufrechnen, nur wundert es mich schon, dass ich als katholischer Christ wesentlich öfter auf die Hexenverfolgung angesprochen werde, die seit einem Vierteljahrhundert der Vergangenheit angehört (jedenfalls soweit es eine europäische, „christlich“ motivierte war), als auf die Christenverfolgung, die jetzt stattfindet.
Völlig unterschlagen wird der innerkirchliche Widerstand engagierter Geistlicher wie Friedrich von Spee SJ, der mit seiner Cautio criminalis seu de processibus contra sagas („Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse“, 1631) Aufklärungsarbeit leistete – lange vor der Epoche der Aufklärung. Spee und andere, etwa Paul Laymann SJ, haben als christliche Hexenwahn-Kritiker in der ersten Hälfte des 17. Jh. (vereinzelt schon im 16. Jh., etwa Johann Weyer) für ein Abebben der Hexenverfolgung in Mitteleuropa gesorgt – mit theologischen Argumenten.
Auch wird oft vergessen zu erwähnen, wie der berüchtigte „Hexenhammer“ (Malleus Maleficarum, 1486) des Heinrich Kramer entstand. Kramer (Institoris) schrieb ihn, weil er in Innsbruck erfolglos einen Hexenprozess angestrengt und kurz darauf des Landes verwiesen wurde. Von wem? Vom Bischof Georg Golser. Der „Hexenhammer“ ist eine Reaktion darauf gewesen. Die Bulle, auf die sich Kramer in Innsbruck berief, „Summis desiderantes affectibus“ (1484), enthielt im Übrigen die Aufforderung, verdächtige Personen ernsthaft zu prüfen und bei bestätigendem Ergebnis zurechtzuweisen, zu inhaftieren und zu bestrafen, nicht aber, sie zu verbrennen. In der Praxis hat das den Hexenwahn eher gemindert als befördert. Kirchenrechtlich hat die „Hexenbulle“ übrigens nie Bedeutung erlangt, maßgebend war immer der Canon episcopi, der Hexenglaube als Einbildung ablehnte und bis zur Kirchenrechtsreform von 1918 im maßgeblichen CIC enthalten war; „Summis desiderantes affectibus“ taucht dagegen in keinem Verzeichnis auf. Die Katholische Kirche hat die Hexenverfolgung niemals offiziell bejaht – im Gegensatz zu Luther und Calvin.
Wer über diese Fakten spricht, dem wird schnell der Titel „Ewiggestriger“ verliehen – interessanterweise von Leuten, die ihr Kirchenbild aus dem Mittelalter entnehmen."