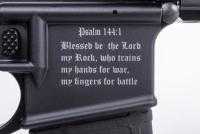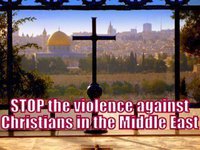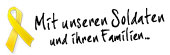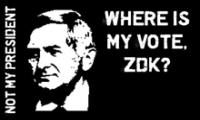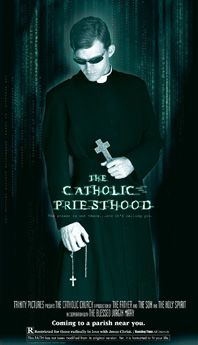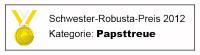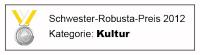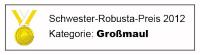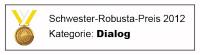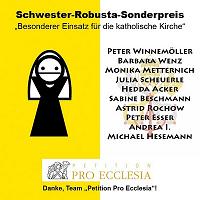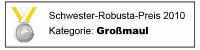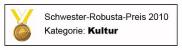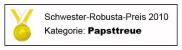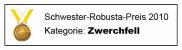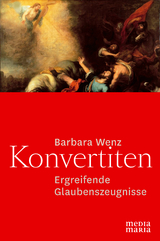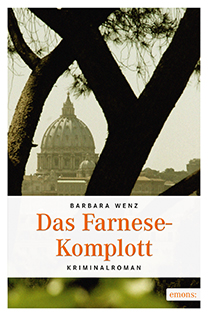Aus dem Schreiben der Glaubenskongregation
an die katholischen Bischöfe über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt:
>>I. DAS PROBLEM
2. In den letzten Jahren haben sich in der Auseinandersetzung mit der Frauenfrage neue Tendenzen abgezeichnet. Eine erste Tendenz unterstreicht stark den Zustand der Unterordnung der Frau, um eine Haltung des Protestes hervorzurufen. So macht sich die Frau, um wirklich Frau zu sein, zum Gegner des Mannes. Auf die Missbräuche der Macht antwortet sie mit einer Strategie des Strebens nach Macht. Dieser Prozess führt zu einer Rivalität der Geschlechter, bei der die Identität und die Rolle des einen zum Nachteil des anderen gereichen. Die Folge davon ist eine Verwirrung in der Anthropologie, die Schaden bringt und ihre unmittelbarste und unheilvollste Auswirkung in der Struktur der Familie hat.
Im Sog dieser ersten Tendenz ergibt sich eine zweite. Um jegliche Überlegenheit des einen oder des anderen Geschlechts zu vermeiden, neigt man dazu, ihre Unterschiede zu beseitigen und als bloße Auswirkungen einer historisch-kulturellen Gegebenheit zu betrachten. Bei dieser Einebnung wird die leibliche Verschiedenheit, Geschlecht genannt, auf ein Minimum reduziert, während die streng kulturelle Dimension, Gender genannt, in höchstem Maß herausgestrichen und für vorrangig gehalten wird. Die Verschleierung der Verschiedenheit oder Dualität der Geschlechter bringt gewaltige Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen mit sich. Diese Anthropologie, die Perspektiven für eine Gleichberechtigung der Frau fördern und sie von jedem biologischen Determinismus befreien wollte, inspiriert in Wirklichkeit Ideologien, die zum Beispiel die Infragestellung der Familie, zu der naturgemäß Eltern, also Vater und Mutter, gehören, die Gleichstellung der Homosexualität mit der Heterosexualität sowie ein neues Modell polymorpher Sexualität fördern.
3. Die unmittelbare Wurzel der genannten Tendenz findet sich im Kontext der Frauenfrage. Ihre tiefste Begründung muss aber im Versuch der menschlichen Person nach Befreiung von den eigenen biologischen Gegebenheiten gesucht werden.[2] Gemäß dieser anthropologischen Perspektive hätte die menschliche Natur keine Merkmale an sich, die sich ihr in absoluter Weise auferlegen: Jede Person könnte und müsste sich nach eigenem Gutdünken formen, weil sie von jeder Vorausbestimmung auf Grund ihrer Wesenskonstitution frei wäre.
Diese Perspektive hat vielfältige Auswirkungen. Zum einen wird dadurch die Meinung bekräftigt, die Befreiung der Frau bringe eine Kritik an der Heiligen Schrift mit sich, die ein patriarchalisches Verständnis von Gott überliefere, das von einer wesentlich männlichen Kultur genährt sei. Zum anderen ist es gemäß dieser Tendenz unwichtig und bedeutungslos, dass der Sohn Gottes die menschliche Natur als Mann angenommen hat.
4. Angesichts dieser Denkströmungen spricht die Kirche hingegen, erleuchtet vom Glauben an Jesus Christus, von aktiver Zusammenarbeit von Mann und Frau bei ausdrücklicher Anerkennung ihrer Verschiedenheit.
Um die Grundlage, den Sinn und die Auswirkungen dieser Antwort besser zu verstehen, ist es angebracht, wenigstens kurz auf die Heilige Schrift zurückzugreifen, die auch reich ist an menschlicher Weisheit. In ihr wurde diese Antwort Schritt für Schritt dank des Eingreifens Gottes zum Wohl des Menschen offenbart.[3]
[2] Zur komplexen Frage des Gender vgl. auch Päpstlicher Rat für die Familie, Familie, Ehe und »de-facto« Lebensgemeinschaften (26. Juli 2000), 8: L'Osservatore Romano. Wochenausgabe in deutscher Sprache (22.Dezember 2000), 8.
[3]Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika Fides et ratio (14. September 1998), 21: AAS 91 (1999) 22: »Diese Öffnung für das Geheimnis, die ihm [dem biblischen Menschen] von der Offenbarung zukam, war schließlich für ihn die Quelle einer wahren Erkenntnis, die seiner Vernunft das Eintauchen in die Räume des Unendlichen erlaubte, wodurch er bis dahin unverhoffte Verständnismöglichkeiten erhielt«.
<<
>>I. DAS PROBLEM
2. In den letzten Jahren haben sich in der Auseinandersetzung mit der Frauenfrage neue Tendenzen abgezeichnet. Eine erste Tendenz unterstreicht stark den Zustand der Unterordnung der Frau, um eine Haltung des Protestes hervorzurufen. So macht sich die Frau, um wirklich Frau zu sein, zum Gegner des Mannes. Auf die Missbräuche der Macht antwortet sie mit einer Strategie des Strebens nach Macht. Dieser Prozess führt zu einer Rivalität der Geschlechter, bei der die Identität und die Rolle des einen zum Nachteil des anderen gereichen. Die Folge davon ist eine Verwirrung in der Anthropologie, die Schaden bringt und ihre unmittelbarste und unheilvollste Auswirkung in der Struktur der Familie hat.
Im Sog dieser ersten Tendenz ergibt sich eine zweite. Um jegliche Überlegenheit des einen oder des anderen Geschlechts zu vermeiden, neigt man dazu, ihre Unterschiede zu beseitigen und als bloße Auswirkungen einer historisch-kulturellen Gegebenheit zu betrachten. Bei dieser Einebnung wird die leibliche Verschiedenheit, Geschlecht genannt, auf ein Minimum reduziert, während die streng kulturelle Dimension, Gender genannt, in höchstem Maß herausgestrichen und für vorrangig gehalten wird. Die Verschleierung der Verschiedenheit oder Dualität der Geschlechter bringt gewaltige Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen mit sich. Diese Anthropologie, die Perspektiven für eine Gleichberechtigung der Frau fördern und sie von jedem biologischen Determinismus befreien wollte, inspiriert in Wirklichkeit Ideologien, die zum Beispiel die Infragestellung der Familie, zu der naturgemäß Eltern, also Vater und Mutter, gehören, die Gleichstellung der Homosexualität mit der Heterosexualität sowie ein neues Modell polymorpher Sexualität fördern.
3. Die unmittelbare Wurzel der genannten Tendenz findet sich im Kontext der Frauenfrage. Ihre tiefste Begründung muss aber im Versuch der menschlichen Person nach Befreiung von den eigenen biologischen Gegebenheiten gesucht werden.[2] Gemäß dieser anthropologischen Perspektive hätte die menschliche Natur keine Merkmale an sich, die sich ihr in absoluter Weise auferlegen: Jede Person könnte und müsste sich nach eigenem Gutdünken formen, weil sie von jeder Vorausbestimmung auf Grund ihrer Wesenskonstitution frei wäre.
Diese Perspektive hat vielfältige Auswirkungen. Zum einen wird dadurch die Meinung bekräftigt, die Befreiung der Frau bringe eine Kritik an der Heiligen Schrift mit sich, die ein patriarchalisches Verständnis von Gott überliefere, das von einer wesentlich männlichen Kultur genährt sei. Zum anderen ist es gemäß dieser Tendenz unwichtig und bedeutungslos, dass der Sohn Gottes die menschliche Natur als Mann angenommen hat.
4. Angesichts dieser Denkströmungen spricht die Kirche hingegen, erleuchtet vom Glauben an Jesus Christus, von aktiver Zusammenarbeit von Mann und Frau bei ausdrücklicher Anerkennung ihrer Verschiedenheit.
Um die Grundlage, den Sinn und die Auswirkungen dieser Antwort besser zu verstehen, ist es angebracht, wenigstens kurz auf die Heilige Schrift zurückzugreifen, die auch reich ist an menschlicher Weisheit. In ihr wurde diese Antwort Schritt für Schritt dank des Eingreifens Gottes zum Wohl des Menschen offenbart.[3]
[2] Zur komplexen Frage des Gender vgl. auch Päpstlicher Rat für die Familie, Familie, Ehe und »de-facto« Lebensgemeinschaften (26. Juli 2000), 8: L'Osservatore Romano. Wochenausgabe in deutscher Sprache (22.Dezember 2000), 8.
[3]Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika Fides et ratio (14. September 1998), 21: AAS 91 (1999) 22: »Diese Öffnung für das Geheimnis, die ihm [dem biblischen Menschen] von der Offenbarung zukam, war schließlich für ihn die Quelle einer wahren Erkenntnis, die seiner Vernunft das Eintauchen in die Räume des Unendlichen erlaubte, wodurch er bis dahin unverhoffte Verständnismöglichkeiten erhielt«.
<<
ElsaLaska - 16. Dez, 20:56