Die Opfer der Bundeswehr.
Mein Interview mit Robert Sedlatzek-Müller. Erschienen am 14. Juni 2012 in der katholischen Tageszeitung Die Tagespost - mit freundlicher Genehmigung hier also nochmals online bei mir nachzulesen. [Im Original-Layout war es natürlich hübscher.]
Die Opfer der Bundeswehr. Von Barbara Wenz.
Robert Sedlatzek-Müller, geboren 1977 in Rostock, ist ein Elitesoldat und Afghanistan-Veteran, der eine Raketenexplosion überlebt hat und schwer traumatisiert nach Hause zurückgekehrt ist. Er leidet unter Alkoholproblemen, unkontrollierbaren Aggressionen und Suizidgedanken, bis endlich die richtige Diagnose gestellt wird: Er ist schwer psychisch erkrankt und seine Krankheit hat einen Namen: Posttraumatische Belastungsstörung. Über seine Geschichte und den Kampf um Unterstützung im Umgang mit dieser Diagnose hat er ein Buch geschrieben:„Soldatenglück. Mein Leben nach dem Überleben.“
Frage: In Ihrem Buch verarbeiten Sie Ihre Erfahrungen bei Einsätzen als Elitekämpfer im Kosovo und in Afghanistan sowie den Umgang mit der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), die Sie davon getragen haben. „Soldatenglück“ ist nicht nur das erschütternde persönliche Zeugnis eines Überlebenden, sondern auch ein zeitgeschichtliches Dokument geworden. Was war Ihre Motivation beim Schreiben?
Posttraumatische Belastungsstörung – das ist die offizielle Bezeichnung einer von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definierten Erkrankung. Entgegen den Erfahrungen aus dem II. Weltkrieg und denen, die andere Krieg führende Nationen in den letzten 50 Jahren gemacht haben, wurde diese Erkrankung innerhalb der Bundeswehr sehr lange ignoriert. Eine Aufklärung dazu gibt es erst seit kurzem. Ich brauchte daher lange, um zu realisieren, dass sich durch das, was ich während meiner Einsätze erlebt habe, meine Psyche verändert hat. Es fiel mir schwer, diese abstrakte Gemütserkrankung, die sich ja auch sehr individuell, abhängig von der Persönlichkeit der Erkrankten, entwickelt, als echte Krankheit zu akzeptieren. Erst als mein Alltag mir so unerträglich wurde, dass ich mich damit konfrontieren musste, habe ich erkannt, dass es durch die PTBS zu massiven Veränderungen im Hormonhaushalt, im Immunsystem, ja sogar im Gehirn und in der Epigenetik des Körpers kommt. Noch schwieriger war es, meinem Umfeld zu vermitteln, was unter der Bezeichnung PTBS zu verstehen ist. Mein Anspruch beim Schreiben von „Soldatenglück” war, zu informieren. Ich wollte den Lesern ermöglichen, für ein paar Stunden in meinen Stiefeln zu marschieren, meine eigene Entwicklung begreiflich machen. Es sollte klar werden, dass eine Posttraumatische Belastungsstörung eine ernst zunehmende Erkrankung ist, die einen zutiefst destruktiven Einfluss auf den Betroffenen wie auch sein Umfeld hat – physisch und psychisch. Ich habe das für mich zu spät erkannt. Das ging auch vielen meiner Kameraden so. Mit dem entsprechenden Wissen hätte ich die ersten Anzeichen eher deuten können. Daher biete ich mich heute als Ansprechpartner an, engagiere mich unter anderem im Bund Deutscher Veteranen für die Aufklärung in der Öffentlichkeit zu dieser Krankheitsform und werbe um Verständnis, Unterstützung und Solidarität für Betroffene.
Frage: Wofür setzen Sie und der Bund der deutschen Veteranen sich darüber hinaus ein?
Der Bund der deutschen Veteranen würde einen offiziellen Veteranentag sehr begrüßen. Dies wäre ein deutliches Zeichen an die Soldaten und ihre Angehörigen. Unsere Soldaten setzen im demokratischen Sinn den Willen des Deutschen Volkes um, wenn sie im Auslandseinsatz sind. Ich fände es wichtig, dass die Gesellschaft die Soldaten mehr würdigt, die diese Aufgabe, oftmals Leid und Entbehrung, übernehmen, um ihr zu dienen.
Frage: Sie führen ein eigenes Weblog, sind auf Facebook präsent und verfolgen intensiv die Art und Weise der Berichterstattung über die Bundeswehr und deren Einsätze in den breiten Medien. Dort kommt es häufig zu Debatten über den Afghanistan-Einsatz, auch durch Aussagen von Zivilisten wie die von Bischöfin Käßmann: Nichts sei gut in Afghanistan. Wie geht es Ihnen damit?
Die Berichterstattung in Deutschland bezüglich unserer Beteiligung am Afghanistaneinsatz empfinde ich als oberflächlich und undurchsichtig - die Debatten als sehr engstirnig. Viel zu selten gibt es Artikel, aus denen hervorgeht, dass es auch noch andere wichtige Gründe als die Terroranschläge vom 11. September 2001 gibt, um sich im Mittleren Osten zu engagieren. Aus der Verkettung der Ereignisse haben sich schließlich auch Chancen ergeben. Leider ist es uns nicht gelungen, das Vertrauen, das man in der afghanischen Bevölkerung gerade den Deutschen entgegen gebracht hatte, zu bestärken. Die deutschen Soldaten konnten zudem nicht auf die emotionale Unterstützung aus der Heimat zurückgreifen, die den amerikanischen Einsatzkräften sicher war. Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundeswehr ihre Einsatzsoldaten mit fundiertem historischem Wissen nach Afghanistan entsendet. Ich komme eigentlich aus einer Familie, in der man sich sehr aktiv für Pazifismus engagiert. Meine Überlegungen brachten und bringen mich aber nach wie vor zu dem Schluss, dass man in der Lage sein sollte, denen, die eine aggressive Vorgehensweise haben, Einhalt zu gebieten. Pazifismus ist eine Utopie, die erst real würde, wenn kein Mensch mehr Aggression zeigte – ich denke, dies entspricht nicht der Natur des Menschen. Das Zitat: „Nichts ist gut in Afghanistan” aus der Neujahrspredigt von Margot Käßmann verstehe ich als den Wunsch nach einer friedlichen Welt ohne Leid. Diesen Wunsch habe ich ebenfalls, ich versuche auf meine Weise dazu beizutragen. Ich halte es auch nicht für widersprüchlich Dichter und Denker zu sein und gleichzeitig Soldat. In der Geschichte gibt es etliche Beispiele, in denen die Feder gegen das Schwert und wieder zurück getauscht wurde.
Frage: Zu Ostermontag zeigte der Privatsender Pro Sieben die deutsche Spielfilmproduktion „Willkommen im Krieg“, die sich selbst als Militär-Komödie sieht und die den Afghanistan-Einsatz der deutschen Bundeswehr als eine Art Klamauk „verarbeitet“. Der Film hat für sehr viel Aufregung, Empörung und auch Wut gesorgt unter Veteranen und Truppenangehörigen. Haben Sie den Film angesehen?
Den Film „Willkommen im Krieg” habe ich nicht gesehen und habe auch nicht das Bedürfnis. Ich finde es grundsätzlich in Ordnung, den Krieg in einer Komödie zu thematisieren. Nach dem, wie der Film beworben wurde, habe ich aber den Eindruck, dass ein seichter Klamauk in ein kontroverses Thema gebettet wurde, um sich engagiert und kritisch geben zu können. Zudem ist mir unangenehm aufgefallen, dass dieser Film ausgerechnet zu Ostern ausgestrahlt wurde. Seit den Gefechten am Karfreitag 2010 in Kunduz, denen viele meiner Kameraden zum Opfer fielen, verbinde ich allerdings Ostern, wie viele andere Afghanistan-Veteranen auch, besonders mit dem Gedenken an die Opfer und das Leid ihrer Angehörigen.
Frage: In einem Artikel für „Die Welt“ aus dem Jahre 2009 postuliert Michael Wolffsohn, Professor für Neuere Geschichte an der Bundeswehruniversität in München unter anderem, dass bürgerliche Werte und klassische Bürgertugenden sowohl in der Zivilgesellschaft wie auch in der uniformierten Gesellschaft immer seltener würden. Unter den Bürgern in Uniform überwiege die Berufs- und eben nicht die Berufungsmentalität. Gibt es tatsächlich eine Berufung zum Soldatsein? Haben Sie eine solche Berufung verspürt? Und für welche Werte stehen Sie ein?
Als Wissenschaftler wird Professor Wolffsohn seine Thesen sicherlich empirisch belegen können. Mein persönlicher Eindruck deckt sich dennoch nicht mit seiner Analyse. Ich habe mit sehr vielen Soldaten gedient, die, so wie ich, aus Berufung zum Militär gegangen sind, und nicht mangels eines anderen Jobs. Gerade bei denen, die noch in der DDR aufgewachsen sind und den so genannten Russland-Deutschen ist der Militärdienst als etwas besonders Ehrenwertes im Denken verankert. Professor Wolffsohn beklagt weiter die „Ent-Intellektualisierung der Bundeswehr”durch die Entwicklung zur Einsatzarmee, die mit einer Ent-Intellektualisierung der Zivilgesellschaft einhergehe. Und ferner postuliert er: „Durch das Desinteresse der Gesellschaft zerbröseln die normativen, konzeptionellen und funktionalen Fundamente unserer Bundeswehr.” Dazu fällt mir folgendes ein: Wenn in unserer Gesellschaft nicht offen über die Bedeutung des Militärs und die Wichtigkeit der Fähigkeit, sich in kriegerische Interventionen einbringen zu können, um auch an Entscheidungen beteiligt zu werden, diskutiert wird, gelingt es der Bundeswehr sicherlich nicht, das intellektuelle Potential an sich zu binden, das sie braucht. Es wird im Gegenteil eine passive Grundhaltung bestärkt, die gerne als Pazifismus deklariert wird. Was mich persönlich betrifft: Die Parole der Französischen Revolution gibt die Werte, für die ich einstehe, am unmissverständlichsten wieder: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!
Frage: Die katholische wie die evangelische Kirche bietet Militärseelsorge und Einsatzbegleitung für Soldaten an. Wie beurteilen Sie den Stellenwert dieses Engagements der Kirchen?
Der rege Zulauf, den die Seelsorger der Kirche gerade im Einsatz erleben, spricht für sich. Während meiner Auslandseinsätze war unser Geistlicher meinen Kameraden und mir immer ein willkommener Gesprächspartner, völlig unabhängig von der jeweiligen Konfession des einzelnen Soldaten. Meines Erachtens obliegt den Militärgeistlichen eine besonders wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, sie sind Ansprechpartner, wenn es um die seelischen Belastungen der Soldaten geht. Sie geben Rat, wenn die Anforderungen an die Soldaten und das christliche Grundverständnis nicht in Einklang gebracht werden kann. Aus unseren Einsätzen sind die Militärseelsorger ebenso wenig wegzudenken wie Sanitäter oder Psychologen.
Frage: Wie soll es in Afghanistan weitergehen? Welche Perspektiven sehen Sie für dieses Land?
Die Idee einer langfristigen Stabilisierung Afghanistans halte ich nach wie vor für richtig. Dafür braucht man Leute mit diplomatischem Geschick und ohne überhebliche Voreingenommenheit. Erst, wenn in der Öffentlichkeit verstanden wird, welche Ziele unser Engagement in Afghanistan verfolgt, kann man auch offen über die Probleme und Gefahren, denen unsere Soldaten in Afghanistan ausgesetzt sind, sprechen, und ihren Einsatz entsprechend würdigen. Man darf die Rolle der Bundeswehr und ihren Einfluss auf die Art, wie die USA als tonangebende Nation ihren „war against terror” führen, nicht überbewerten. Deutschlands Stärken liegen in der Diplomatie und in der Technologie. Militärisch sind wir auf unsere Bündnispartner angewiesen. Wenn das US-Militär abzieht, ist auch für die Bundeswehr der Einsatz in Afghanistan beendet. Dieses Land wird aber auch über 2014 hinaus eine Schlüsselfunktion in einer Region von großer strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung behalten. Wenn Deutschland es jetzt nicht schafft, den Grundstein für eine gute Beziehung zu Afghanistan zu legen, werden die Opfer, die wir bei diesem Einsatz gebracht haben, vergebens gewesen sein.
Ende des Tagespostartikels.
[Vielen lieben Dank, Robert. Du hast das Interview in einer sehr harten Zeit gemacht - und ich finde, es ist ganz toll geworden.]
Die Opfer der Bundeswehr. Von Barbara Wenz.
Robert Sedlatzek-Müller, geboren 1977 in Rostock, ist ein Elitesoldat und Afghanistan-Veteran, der eine Raketenexplosion überlebt hat und schwer traumatisiert nach Hause zurückgekehrt ist. Er leidet unter Alkoholproblemen, unkontrollierbaren Aggressionen und Suizidgedanken, bis endlich die richtige Diagnose gestellt wird: Er ist schwer psychisch erkrankt und seine Krankheit hat einen Namen: Posttraumatische Belastungsstörung. Über seine Geschichte und den Kampf um Unterstützung im Umgang mit dieser Diagnose hat er ein Buch geschrieben:„Soldatenglück. Mein Leben nach dem Überleben.“
Frage: In Ihrem Buch verarbeiten Sie Ihre Erfahrungen bei Einsätzen als Elitekämpfer im Kosovo und in Afghanistan sowie den Umgang mit der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), die Sie davon getragen haben. „Soldatenglück“ ist nicht nur das erschütternde persönliche Zeugnis eines Überlebenden, sondern auch ein zeitgeschichtliches Dokument geworden. Was war Ihre Motivation beim Schreiben?
Posttraumatische Belastungsstörung – das ist die offizielle Bezeichnung einer von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definierten Erkrankung. Entgegen den Erfahrungen aus dem II. Weltkrieg und denen, die andere Krieg führende Nationen in den letzten 50 Jahren gemacht haben, wurde diese Erkrankung innerhalb der Bundeswehr sehr lange ignoriert. Eine Aufklärung dazu gibt es erst seit kurzem. Ich brauchte daher lange, um zu realisieren, dass sich durch das, was ich während meiner Einsätze erlebt habe, meine Psyche verändert hat. Es fiel mir schwer, diese abstrakte Gemütserkrankung, die sich ja auch sehr individuell, abhängig von der Persönlichkeit der Erkrankten, entwickelt, als echte Krankheit zu akzeptieren. Erst als mein Alltag mir so unerträglich wurde, dass ich mich damit konfrontieren musste, habe ich erkannt, dass es durch die PTBS zu massiven Veränderungen im Hormonhaushalt, im Immunsystem, ja sogar im Gehirn und in der Epigenetik des Körpers kommt. Noch schwieriger war es, meinem Umfeld zu vermitteln, was unter der Bezeichnung PTBS zu verstehen ist. Mein Anspruch beim Schreiben von „Soldatenglück” war, zu informieren. Ich wollte den Lesern ermöglichen, für ein paar Stunden in meinen Stiefeln zu marschieren, meine eigene Entwicklung begreiflich machen. Es sollte klar werden, dass eine Posttraumatische Belastungsstörung eine ernst zunehmende Erkrankung ist, die einen zutiefst destruktiven Einfluss auf den Betroffenen wie auch sein Umfeld hat – physisch und psychisch. Ich habe das für mich zu spät erkannt. Das ging auch vielen meiner Kameraden so. Mit dem entsprechenden Wissen hätte ich die ersten Anzeichen eher deuten können. Daher biete ich mich heute als Ansprechpartner an, engagiere mich unter anderem im Bund Deutscher Veteranen für die Aufklärung in der Öffentlichkeit zu dieser Krankheitsform und werbe um Verständnis, Unterstützung und Solidarität für Betroffene.
Frage: Wofür setzen Sie und der Bund der deutschen Veteranen sich darüber hinaus ein?
Der Bund der deutschen Veteranen würde einen offiziellen Veteranentag sehr begrüßen. Dies wäre ein deutliches Zeichen an die Soldaten und ihre Angehörigen. Unsere Soldaten setzen im demokratischen Sinn den Willen des Deutschen Volkes um, wenn sie im Auslandseinsatz sind. Ich fände es wichtig, dass die Gesellschaft die Soldaten mehr würdigt, die diese Aufgabe, oftmals Leid und Entbehrung, übernehmen, um ihr zu dienen.
Frage: Sie führen ein eigenes Weblog, sind auf Facebook präsent und verfolgen intensiv die Art und Weise der Berichterstattung über die Bundeswehr und deren Einsätze in den breiten Medien. Dort kommt es häufig zu Debatten über den Afghanistan-Einsatz, auch durch Aussagen von Zivilisten wie die von Bischöfin Käßmann: Nichts sei gut in Afghanistan. Wie geht es Ihnen damit?
Die Berichterstattung in Deutschland bezüglich unserer Beteiligung am Afghanistaneinsatz empfinde ich als oberflächlich und undurchsichtig - die Debatten als sehr engstirnig. Viel zu selten gibt es Artikel, aus denen hervorgeht, dass es auch noch andere wichtige Gründe als die Terroranschläge vom 11. September 2001 gibt, um sich im Mittleren Osten zu engagieren. Aus der Verkettung der Ereignisse haben sich schließlich auch Chancen ergeben. Leider ist es uns nicht gelungen, das Vertrauen, das man in der afghanischen Bevölkerung gerade den Deutschen entgegen gebracht hatte, zu bestärken. Die deutschen Soldaten konnten zudem nicht auf die emotionale Unterstützung aus der Heimat zurückgreifen, die den amerikanischen Einsatzkräften sicher war. Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundeswehr ihre Einsatzsoldaten mit fundiertem historischem Wissen nach Afghanistan entsendet. Ich komme eigentlich aus einer Familie, in der man sich sehr aktiv für Pazifismus engagiert. Meine Überlegungen brachten und bringen mich aber nach wie vor zu dem Schluss, dass man in der Lage sein sollte, denen, die eine aggressive Vorgehensweise haben, Einhalt zu gebieten. Pazifismus ist eine Utopie, die erst real würde, wenn kein Mensch mehr Aggression zeigte – ich denke, dies entspricht nicht der Natur des Menschen. Das Zitat: „Nichts ist gut in Afghanistan” aus der Neujahrspredigt von Margot Käßmann verstehe ich als den Wunsch nach einer friedlichen Welt ohne Leid. Diesen Wunsch habe ich ebenfalls, ich versuche auf meine Weise dazu beizutragen. Ich halte es auch nicht für widersprüchlich Dichter und Denker zu sein und gleichzeitig Soldat. In der Geschichte gibt es etliche Beispiele, in denen die Feder gegen das Schwert und wieder zurück getauscht wurde.
Frage: Zu Ostermontag zeigte der Privatsender Pro Sieben die deutsche Spielfilmproduktion „Willkommen im Krieg“, die sich selbst als Militär-Komödie sieht und die den Afghanistan-Einsatz der deutschen Bundeswehr als eine Art Klamauk „verarbeitet“. Der Film hat für sehr viel Aufregung, Empörung und auch Wut gesorgt unter Veteranen und Truppenangehörigen. Haben Sie den Film angesehen?
Den Film „Willkommen im Krieg” habe ich nicht gesehen und habe auch nicht das Bedürfnis. Ich finde es grundsätzlich in Ordnung, den Krieg in einer Komödie zu thematisieren. Nach dem, wie der Film beworben wurde, habe ich aber den Eindruck, dass ein seichter Klamauk in ein kontroverses Thema gebettet wurde, um sich engagiert und kritisch geben zu können. Zudem ist mir unangenehm aufgefallen, dass dieser Film ausgerechnet zu Ostern ausgestrahlt wurde. Seit den Gefechten am Karfreitag 2010 in Kunduz, denen viele meiner Kameraden zum Opfer fielen, verbinde ich allerdings Ostern, wie viele andere Afghanistan-Veteranen auch, besonders mit dem Gedenken an die Opfer und das Leid ihrer Angehörigen.
Frage: In einem Artikel für „Die Welt“ aus dem Jahre 2009 postuliert Michael Wolffsohn, Professor für Neuere Geschichte an der Bundeswehruniversität in München unter anderem, dass bürgerliche Werte und klassische Bürgertugenden sowohl in der Zivilgesellschaft wie auch in der uniformierten Gesellschaft immer seltener würden. Unter den Bürgern in Uniform überwiege die Berufs- und eben nicht die Berufungsmentalität. Gibt es tatsächlich eine Berufung zum Soldatsein? Haben Sie eine solche Berufung verspürt? Und für welche Werte stehen Sie ein?
Als Wissenschaftler wird Professor Wolffsohn seine Thesen sicherlich empirisch belegen können. Mein persönlicher Eindruck deckt sich dennoch nicht mit seiner Analyse. Ich habe mit sehr vielen Soldaten gedient, die, so wie ich, aus Berufung zum Militär gegangen sind, und nicht mangels eines anderen Jobs. Gerade bei denen, die noch in der DDR aufgewachsen sind und den so genannten Russland-Deutschen ist der Militärdienst als etwas besonders Ehrenwertes im Denken verankert. Professor Wolffsohn beklagt weiter die „Ent-Intellektualisierung der Bundeswehr”durch die Entwicklung zur Einsatzarmee, die mit einer Ent-Intellektualisierung der Zivilgesellschaft einhergehe. Und ferner postuliert er: „Durch das Desinteresse der Gesellschaft zerbröseln die normativen, konzeptionellen und funktionalen Fundamente unserer Bundeswehr.” Dazu fällt mir folgendes ein: Wenn in unserer Gesellschaft nicht offen über die Bedeutung des Militärs und die Wichtigkeit der Fähigkeit, sich in kriegerische Interventionen einbringen zu können, um auch an Entscheidungen beteiligt zu werden, diskutiert wird, gelingt es der Bundeswehr sicherlich nicht, das intellektuelle Potential an sich zu binden, das sie braucht. Es wird im Gegenteil eine passive Grundhaltung bestärkt, die gerne als Pazifismus deklariert wird. Was mich persönlich betrifft: Die Parole der Französischen Revolution gibt die Werte, für die ich einstehe, am unmissverständlichsten wieder: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!
Frage: Die katholische wie die evangelische Kirche bietet Militärseelsorge und Einsatzbegleitung für Soldaten an. Wie beurteilen Sie den Stellenwert dieses Engagements der Kirchen?
Der rege Zulauf, den die Seelsorger der Kirche gerade im Einsatz erleben, spricht für sich. Während meiner Auslandseinsätze war unser Geistlicher meinen Kameraden und mir immer ein willkommener Gesprächspartner, völlig unabhängig von der jeweiligen Konfession des einzelnen Soldaten. Meines Erachtens obliegt den Militärgeistlichen eine besonders wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, sie sind Ansprechpartner, wenn es um die seelischen Belastungen der Soldaten geht. Sie geben Rat, wenn die Anforderungen an die Soldaten und das christliche Grundverständnis nicht in Einklang gebracht werden kann. Aus unseren Einsätzen sind die Militärseelsorger ebenso wenig wegzudenken wie Sanitäter oder Psychologen.
Frage: Wie soll es in Afghanistan weitergehen? Welche Perspektiven sehen Sie für dieses Land?
Die Idee einer langfristigen Stabilisierung Afghanistans halte ich nach wie vor für richtig. Dafür braucht man Leute mit diplomatischem Geschick und ohne überhebliche Voreingenommenheit. Erst, wenn in der Öffentlichkeit verstanden wird, welche Ziele unser Engagement in Afghanistan verfolgt, kann man auch offen über die Probleme und Gefahren, denen unsere Soldaten in Afghanistan ausgesetzt sind, sprechen, und ihren Einsatz entsprechend würdigen. Man darf die Rolle der Bundeswehr und ihren Einfluss auf die Art, wie die USA als tonangebende Nation ihren „war against terror” führen, nicht überbewerten. Deutschlands Stärken liegen in der Diplomatie und in der Technologie. Militärisch sind wir auf unsere Bündnispartner angewiesen. Wenn das US-Militär abzieht, ist auch für die Bundeswehr der Einsatz in Afghanistan beendet. Dieses Land wird aber auch über 2014 hinaus eine Schlüsselfunktion in einer Region von großer strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung behalten. Wenn Deutschland es jetzt nicht schafft, den Grundstein für eine gute Beziehung zu Afghanistan zu legen, werden die Opfer, die wir bei diesem Einsatz gebracht haben, vergebens gewesen sein.
Ende des Tagespostartikels.
[Vielen lieben Dank, Robert. Du hast das Interview in einer sehr harten Zeit gemacht - und ich finde, es ist ganz toll geworden.]
ElsaLaska - 25. Jun, 21:22





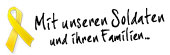
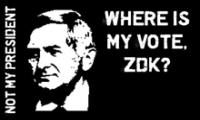










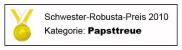








ja, aber
2. Es ist eine interessante These, dass es zum Wesen des Menschen gehört, aggressiv zu sein. Bedeutet es, sich damit abfinden zu müssen? "Wenn Du Frieden willst, dann erforsche, wie Du ihn erreichen kannst!" - so müsste der olle Clausewitz nach meinem Empfinden heute endlich umgedeutet werden.
3. Die strategische Schlüsselfunktion Afghanistans - sorry: das ist Militärdenke, Kriegssprech. Ich lehne es entschieden ab, mir das zu eigen zu machen. Dass Pazifismus eine Utopie ist, würde ich bestreiten - und füge zugleich hinzu, dass die Menschheit dringendst Utopien braucht, um zu überleben!
@fbtde
Robert war als Entschärfer von Sprengstoff, Raketen, Minen und soweiter unterwegs - er hatte auch einen eigens dafür ausgebildeten Hund, Idor - sein treuester Gefährte. Der leider um die Zeit des Interviews verstorben ist.
Bei einem dieser Einsätze kam es zu einem schrecklichen Unglück an dem er keine Schuld trug, bei dem Kameraden starben und er eben traumatisiert wurde.
Ich kann Dir wirklich nur empfehlen, sein Buch zu lesen.
Dann verstehst Du ihn vielleicht besser. Und auch Soldaten generell.
@FBTDE
Was die Aggressivität von Menschen angeht musste ich mich vor vielen Jahre, ziemlich genau zehn, um genau zu sein, mal fürchterlich mit meiner Deutschlehrerin anlegen. Die war auch ganz entsetzt, als wir meinten, Aggressionen wären normal. Sie hat dann durchaus aggressiv reagiert, nur halt nicht mit physischer Gewalt. Aggression ist normaler Bestandteil menschlichen Verhaltens. Das ist keine "interessante These", sondern ein anthropologischer Fakt. Aggression ist nichts, was wir irgendwie durch entsprechende Erziehung "wegmachen " können. Es ändert sich höchstens die Art und Weise, wie sich Aggression überwiegend äußert bzw. die Bewertung, welche Art und Weise als sozial angemessen gilt. Und da es immer Aggression geben wird, kann man sich vielleicht nochmal in Ruhe hinsetzen und überlegen, ob Pazifismus wirklich so eine tolle Sache ist. Mal davon abgesehen, daß ich Utopien für potentiell lebensgefährlich halte und sie eben die Eigenschaft haben, nicht realisierbar zu sein (Utopie= Nicht-Ort) - Pazifismus ist für mich keine Utopie, sondern eine Dystopie. Weil: wenn ich für mich selbst beschließe, mich selbst nicht physisch zu verteidigen, mag das ja noch angehen. Pazifismus wird aber da zum Verbrechen, wo er dazu führt, daß man andere, die angegriffen oder massiv unterdrückt werden, nicht verteidigt. Mit Pazifismus hält man Schlächter nicht auf, was man leider prima in Rwanda beobachten konnte, wo die Blauhelme ihre Waffen nicht einsetzen durften, um den Völkermord zu unterbinden. Kleine Mädchen mit Gitarre und Blümchen werden die Taliban nicht zur Vernunft bringen, und ich fürchte, diverse Terroristen auf diesem Planeten sind rationalen Argumenten auch nicht so ganz zugänglich. Also, Krieg vermeiden wo es geht, Gewalt vermeiden, wo es geht, aber Pazifismus bitte in die Mottenkiste zu den anderen Utopien. Danke.