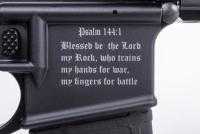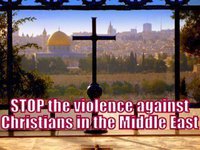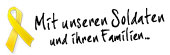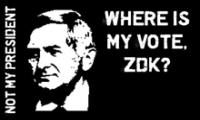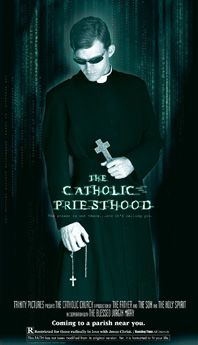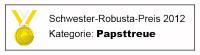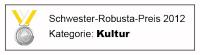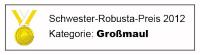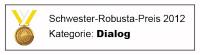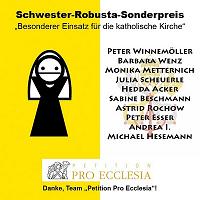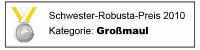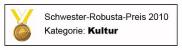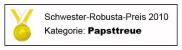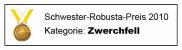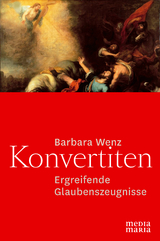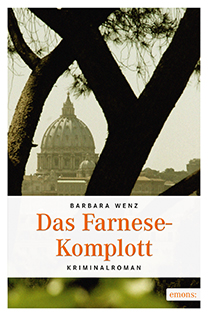Studium
"Die Zeit der lutherischen Reformation und katholischen Restauration war eine Zeit des "entsiegelten Abgrunds" (Offb 6): Krieg, Not, Tod, Erdbeben, bis die Hölle selbst zu rasen schien, da die Menschheit Teufel und Besessene überall sah und im Kampf gegen sie selber einer angstgejagten Besessenheit der Grausamkeit verfiel. Dann schlug die Zeit der Hexenbrände jäh in die Zeit der Aufklärung um, wo derselben Menschheit dies alles so sehr entschwand, dass auch der lebendige Gott ihr entschwand, da nur noch die "Ideen" der enzyklopädischen "Natur, Vernunft, Moral" und der revolutionären "Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit" einen Himmel bildeten, der von einer utopisch "glücklichen Erde" sich nicht unterschied. Aber die letzten Fanale der Hexenbrände düsterten doch noch bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, - und das beginnende 20. Jh. zeigt bereits die ersten Spuren einer neuen Zeit des "entsiegelten Abgrunds": Psychoanalyse und Individualpsychologie entstehen als der verzweifelte Versuch, der neurotische Besessenheiten Herr zu werden, die der Erfolg der aufklärerischen Vernunftreligion sind.
Die Aufklärung hat alles aufgeklärt, bis auch der Abgrund wieder klar ist. Von der lutherischen Heilsgewissheit zur Descartschen Selbstgewissheit ... geht der verzweifelte Versuch der Menschheit, jener dämonischen Angst Herr zu werden, die den Begründer der Reformation, Luther, schüttelte. Dieser Versuch ist heute in die Philosophie Martin Heideggers geendet, für die eben diese Angst Wesen des Sein ward, weil das hoffnungslos absolute Nichts Untergrund des Sein ist.. Dann aber kündet sich in der Art, wie diese Angst-Metaphysik Heideggers die Angst-Mystik der kleinen Blanche in Gertrud Le Forts "Letzte am Schafott" gegenübersteht, auch die Erneuerung des Letzten, was die Zeit der lutherischen Reformation und katholischen Restauration kennzeichnet. Im Durchleiden dieser letzten Angst, die nicht mehr eigentlich "Angst vor" ..., sondern "Angst schlechthin" [ist] - hierin gehen die großen Persönlichkeiten der lutherischen Reformation und katholischen Restauration noch einige: Luther, Bach auf der einen Seite, Ignatius von Loyola und Teresa von Avila auf der anderen. Aber dann scheiden sich die Wege jäh."
Erich Przywara, SJ: Humanitas. Der Mensch gestern und morgen.
ElsaLaska - 27. Apr, 11:04
"Im Werke Gertrud Le Forts steht Rom als Wirklichkeit und Gleichnis. Es ist Rom, wie es eine stolze, heidnische Klassik in einer aufgebrochenen Romantik innerlich überwindet. Es ist Rom, wie es die Sehnsuchts-Halbheit einer siechenden Romantik sterben lässt in eine übernatürliche Klassik des "Kindes der Heiligen Kirche". Es ist Rom, wie es erst dem aufgerissenen Blick eines Eschatologismus sichtig wird, der durch die Schauer der letzten Nächte schritt. Es ist Rom, wie es das Dämonische dieses Eschatologismus zur Kraft der Kindlichkeit umopfert.
In der Gestalt der Großmutter der kleinen Veronika ist das Rom Stefan Georges einheitliches Bild, einheitlich seiner ruhenden Majestät, einheitlich in seinen geheimen, eine unaufhörlich blutende Wunde hüllenden Verkleidungen einheitlich in seiner letzten Todes-Schwermut, in die die Peterskuppel fern hineindämmert. In der Zerrissenheit Enzios dunkelt ds Rom der ungeheuren Gräber-Nacht, seine Ewige Unendlichkeit des Chaotischen, die unter den Trümmern wühlt, einheitlich in der Größe der Durchbrechung aller schränkenden Formen, einheitlich in den Steppen-Weiten ihrer Grenzlosigkeit, einheitlich im Weinen ihrer Einsamkeit.
Die zerbrechliche und doch unglaublich zähe Kristallizität Tante Edelgards spricht von der spitzenfeinen Subtilität eines rein unsichtbaren Rom, Rom rein geistiger Religiösität, das zurückbebt vor dem wuchtend sichtbaren Rom der "Monstranz" der Peterskuppel, zurückbebt in einer letzten Selbsttäuschung des "ich bin nicht würdig", zurückbebt in einer letzten dämonischen Anfechtung des "sich auch gegen Gottes allzu große Nähe wahren müssen", zurückbebt schließlich in einem Ausbruch, der alle Subtilität dämonisch-leidenschaftlich zerfetzt, um in diesem Ausbruch als selig tödlich getroffenes Wild dem göttlichen Jäger der Liebe in die Arme zu sinken, im Atem eines rücksichtslosen, alle Türen des Hauses geheimnisvoll aufbrechenden Confiteor."
Erich Przywara, SJ: Humanitas. Der Mensch gestern und morgen.
ElsaLaska - 26. Apr, 13:00
"Wenn wir einen Vogel im Flug wahrzunehmen meinen und bei näherem Zusehen bemerken, daß es sich faktisch um ein herabfallendes Blatt handelt, so ist unsere Wahrnehmung als Täuschung entlarvt, und wir müssen alle unsere Aussagen über den fliegenden Vogel zurücknehmen, die den Anspruch erhoben, Erfahrungstatsachen Ausdruck zu geben. Daß wir aber die Wahrnehmung eines fliegenden Vogels hatten, dieser Tatbestand ist unaufhebbar und kann durch keine neue Erfahrung angetastet werden. Und alles, was zu diesem Phänomen: Wahrnehmung des fliegenden Vogels gehört, kann beschrieben werden, und diese Beschreibung bleibt wahr, auch wenn die Wahrnehmung sich als trügerisch herausgestellt hat.
...
Der Charakter der (Wahrnehmungs)Intention als solcher und jedes einzelne ihrer besonderen Merkmale weist darauf hin, daß das Erlebnis nicht vollständig beschrieben ist, wenn man nur die Subjektseite beschreibnt, ja daß man die Subjektseite gar nicht bechreiben kann, ohne ständig zugleich ihren Gegenpol ins Auge zu fassen: das Gegenständliche, dem das Erlebnis gilt. (D.h. das Wahrgenommen muss mitbeschrieben werden).
...
Aber wohlgemerkt: wenn ich in der ... phänomenologischen Einstellung ... den fliegenden Vogel beschreibe, so beschreibe ich kein Naturding, gebe keiner natürlichen Erfahrung Ausdruck, sondern gebe nur getreu wieder, was im Wahrnehmungserlebnis beschlossen liegt. Die Wahrnehmung ist Wahrnehmung eines so und so erscheinenden Gegenstandes, und das bleibt wahr, auch wenn die Wahrnehmung sich als Täuschung herausstellt und der wahrgenommene Gegenstand nicht existiert oder doch etwas anderes ist, als man meinte, solange das Wahrnehmungserlebnis dauerte."
Stein, Edith: Einführung in die Philosophie.
ElsaLaska - 1. Feb, 13:34
der schöne Ausdruck "Rettungsfolter" begegnet. Prof. Dr. Winfried Brugger ist der Auffassung, dass das Folterverbot staatlich gelockert werden sollte, um in Extremfällen die Würde der potentiellen Opfer von Terroristen zu schützen.
Prof. Dr. Brugger verweist gleich zu Beginn
dieses Artikels in Politik und Zeitgeschichte Nr 36/2006 auf den populären Fall, in dem der Polizeivizepräsident Daschner dem Kindermörder Gäfgen Gewalt angedroht hatte.
Nun ist Androhung von Gewalt aber noch nicht Anwendung von Gewalt, das wird innerhalb der Diskussion merkwürdigerweise gerne vergessen.
Prof. Dr. Brugger denkt vor allen an den einzelnen Polizisten und ist besorgt. "Sollten wir Polizisten in eine solche Entscheidungsnot bringen? Das ist unmenschlich und zynisch. Entweder gilt das Folterverbot absolut, weil es so angeordnet und auch gerecht ist: Dann bleibt kein Raum für moralisches Verständnis und Hoffen auf Rechtsbruch mit anschließender milder Rechtssanktion. Oder es ist in der genannten Situation evident ungerecht und die Relativierung ist bei näherem Hinsehen schon im geltenden Recht angelegt: Dann muss die Ausnahme interpretativ oder legislativ formuliert werden, damit wir selbst, das gesamte Volk, für Recht und Gerechtigkeit und, wo immer möglich, für Zivilität und Würdewahrung einstehen." (aus dem o.g. Artikel).
Ich habe im Grunde gar nichts gegen staatliche Ver- oder Gebote. Wie nützlich die sind, sieht man am Beispiel Singapur. Eine wunderschön saubere Stadt. Wenn sie aber nur noch dazu dienen sollen, individuelle Entscheidungen abzuwälzen und das Gewissen des Individuums möglichst zu entlasten, damit dieses "reibungsloser funktionieren" kann, halte ich rein gar nichts davon.
Im Falle von "Rettungsfolter" meine ich, dass wir Polizisten durchaus in Entscheidungsnot bringen sollten. Wir brauchen mehr Einzelne, ethisch und moralisch durchgeformt und auf einem hohen Niveau persönlicher Verantwortung, und nicht noch mehr ferngesteuerte Luschen. Und schon gar nicht brauchen wir ein Volk ferngesteuerter Luschen, welches in seiner Gesamtheit für die Anwendung von Folter einstehen darf.
Edit hierzu: Der Artikel "Heldengedenken" von Oliver Maskan zum Stauffenberg-Gedenken "wider das geschichtspolitische Diktat", welcher in Anklängen auch grob das umreißt, was ich meinte mit der persönlichen Verantwortung, die mittlerweile nicht mehr dem Zeitgeist entspricht:
"Der Held ist der, der aus der Masse tritt. Er ist damit das Gegenbild zum Egalitarismus, der meint, alle Menschen auf sein moralisches Mittelmaß reduzieren zu dürfen. Vulgarität kann man das auch nennen. Sinnenfälliger Ausdruck dieser heute weitverbreiteten Gesinnung ist die Art und Weise, in der heute auf deutschen Bühnen heldische Stoffe inszeniert werden. Die antike Tragödie, die vom Ringen des Helden mit widerstreitenden moralischen Ansprüchen lebt – klassisch in der Gestalt der Antigone –, erscheint den meisten Regisseuren als Wichtigtuerei oder Torheit."
Und diesem Zeitgeist ist, hier hat Maksan völlig Recht, auch geschuldet die Ignoranz der Lebenssituation von Bundeswehrsoldaten:
"Die Bereitschaft der Soldaten, für Recht und Freiheit immer häufiger ihr eigenes Leben riskieren zu müssen, findet keine Anerkennung seitens der Gemeinschaft, sondern wird als Berufsrisiko in das Ermessen der Einzelnen gestellt und damit aus dem gesellschaftlichen Diskurs entsorgt.
Natürlich ist dieser anti-heroische Affekt verständlich ..."ElsaLaska - 1. Feb, 10:21
ein interessanter
Artikel zu den Kantschen Antinomien. Gut zusammengefasst und erklärt, finde ich, auch wenn die Überschrift "Kritik bürgerlicher Wissenschaft" ein bisschen treuherzig klingt ...
ElsaLaska - 21. Jan, 14:19
"Es ist klar, daß hier nicht das Gespräch unter Spezialisten und über ein nur den Spezialisten interessierendes Thema gemeint ist. Gemeint ist das Gespräch über die den "Menschen überhaupt" betreffenden Gegenstände, die aber, natürlicherweise, von der Einzelforschung her immer neu fraglich gestellt werden und also immer neu zur Diskussion gestellt werden. Ich weiß sehr wohl, daß zu einem Streitgespräch dieser Art [gemeint ist die scholastische disputatio in ihrer strengen Form] einige Voraussetzungen gehören, die in den mittelalterlichen Universitäten offenkundig erfüllt waren und die heute anscheinend nicht erfüllt sind, zum Beispiel die gemeinsame Sprache und die einigermaßen einheitliche philosophisch-theologische Weltsicht. Aber es ist vielleicht doch nicht eine völlig utopische Zielsetzung, eine Erneuerung unserer Hochschulen zu versuchen - aus d e n Prinzipien, die das Werden der abendländischen Universität bestimmt haben, wozu unter anderem das Streitgespräch gehört. Es ist eben die Rede davon gewesen, welche Reinigung des öffentlichen Wesens durch die Beachtung einer bestimmten Disputationsregel in Gang gebracht werden könnte. Natürlich kann so etwas nur im modus irrealis gesagt werden. Wer aber nach den Gründen fragt, warum denn die öffentliche Diskussion so hoffnungslos entarten konnte, der kann sehr wohl auf den Gedanken kommen, vielleicht fehle nur das Paradigma, das "Modell", das überzeugende und normsetzende Beispiel der disputatio an dem Ort, an dem sie natürlicherweise zu Hause sein sollte: an der Universität."
Pieper, Josef: Thomas von Aquin. Leben und Werk.
ElsaLaska - 28. Dez, 21:44
"[Weil die Geschichte] uns an unsere Grenzen rühren ließ, behaupte ich, daß wir alle metaphysische Schriftsteller sind. Wahrscheinlich werden viele von uns diese Bezeichnung ablehnen oder nicht ohne Vorbehalt akzeptieren; das rührt aber von einem Mißverständnis her: die Metaphysik ist nämlich nicht eine unfruchtbare Diskussion über abstrakte Begriffe, die sich der Erfahrung entziehen, sondern ein lebendiges Bemühen, die menschliche Situation von innen her in ihrer Totalität zu erfassen."
Sartre, J.-P.: Was ist Literatur. Reinbek, 1965.
ElsaLaska - 15. Dez, 18:24
"Es entsteht nun natürlich die Frage: wo denn heute und hier die legitime vor-philosophische Überlieferung zu finden sei. Welches ist die gegenwärtig antreffbare Gestalt der, wie Platon sagt, 'durch einen unbekannten Prometheus als eine Gabe der Götter zu uns herabgelangten Kunde?' Darauf wird man antworten müssen: daß es seit dem Ausgang der Antike im Abendland keine das Ganze der Welt betreffende vorphilosophische Überlieferung gibt außer der christlichen. Es gibt heute, im Abendland, keine Theologie, es sei denn die christliche! Wo wäre eine nicht-christliche Theologie im vollen Sinn denn wohl zu finden?"
[Pieper führt das in einer Fußnote aus]:
"[...] es sei doch, etwa im Werke von Walter F. Otto, heute ein Wiederaufleben der antiken Theologie festzustellen, so daß man nicht mehr sagen könne, die einzig anzutreffende Theologie sei die christliche. Darauf ist zu sagen: Bewunderung ist noch nicht Glaube. Will man im Ernst behaupten, es werde, in jenem neuen Griechentum, die antike Theologie im präzisen Sinn 'als Wahrheit angenommen', so völlig 'geglaubt', daß etwa, in einer äußerst existentiellen Situation (im Angesicht des Todes), zu Apollon oder zu Dionysos gebetet werden könne?
Wenn dies aber nicht zutrifft, dann kann von einer Theologie im vollen Sinne nicht die Rede sein."
Pieper, Josef: Was heißt Philosophieren?
ElsaLaska - 9. Dez, 13:46
Da wir es gerade von Josef Pieper hatten, hier der Link zur
Josef-Pieper-Arbeitsstelle der Theologischen Fakultät Paderborn mit interessanten Beiträgen zu Person und Werk, zum Forschungsstand und zur Primär- wie auch Sekundärliteratur.
ElsaLaska - 7. Dez, 17:50
im geistigen Sinn? Vor allem dieses: daß einer die von den unmittelbaren Lebenszwecken her bestimmte Nahumwelt so sehr endgültig, so kompakt nimmt, daß die begegnenden Dinge nicht mehr durchsichtig zu werden vermögen. Die größere, tiefere und eigentlichere, zunächst unsichtbare Welt der Wesenheiten wird nicht mehr geahnt; das Erstaunliche kommt nicht mehr vor, es kommt nicht mehr hervor: der Mensch vermag nicht mehr zu staunen.
Der stumpfgewordene Spießersinn findet alles selbstverständlich.
Was aber ist denn in Wahrheit selbstverständlich? Ist es etwa selbstverständlich, daß wir sind; ist es selbstverständlich, daß es so etwas gibt wie Sehen? So kann der in den Alltag, den inneren Alltag Eingesperrte nicht fragen - schon deswegen nicht, weil es ihm nicht gelingt (jedenfalls nicht wachen Sinnes, höchstens in der Betäubung) - weil es ihm nicht gelingt, die unmittelbaren Lebenszwecke auf einmal zu vergessen, während gerade dies den Staunenden kennzeichnet: daß für ihn, für den durch das tiefere Antlitz der Welt betroffenen Menschen die unmittelbaren Lebenszwecke schweigen - und sei es nur für diesen einene Augenblick des betroffenen Hinblickens auf das staunenerregende Antlitz der Welt."
Pieper, Josef: Was heißt Philosophieren?
ElsaLaska - 6. Dez, 14:04