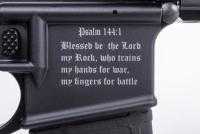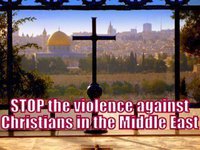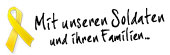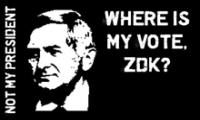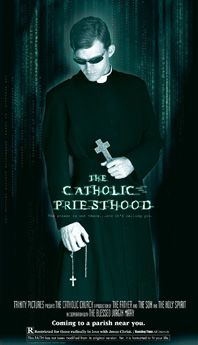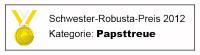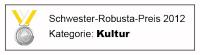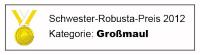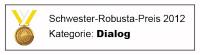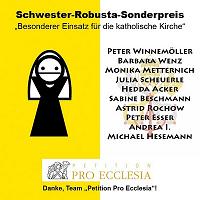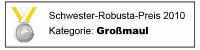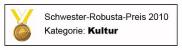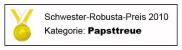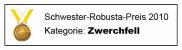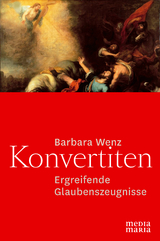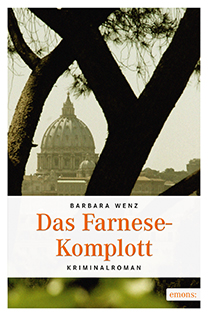Studium
Aus von Hildebrands Appell an die Gläubigen in seinem Nachwort - Teil I:
>>Dieses Buch ist aus einem tiefen Schmerz über das Auftauchen falscher Propheten in der Stadt Gottes geschrieben. Es ist traurig genug, wenn Menschen ihren Glauben verlieren und die Kirche verlassen. Aber es ist viel schlimmer, wenn diejenigen, die in Wirklichkeit ihren Glauben verloren haben, in der Kirche bleiben und - wie Termiten - versuchen, den christlichen Glauben durch ihre Behauptung auszuhöhlen, daß sie der göttlichen Offenbarung die Interpretation geben, die zum "modernen Menschen" paßt.
Ich möchte dieses Buch mit einem Appell an all jene schließen, deren Glaube nicht zerstört ist, sich vor diesen falschen Propheten zu hüten, die Christus der weltlichen Stadt ausliefern wollen, ähnlich wie Judas Jesus in die Hände Seiner Verfolger überliefert hat.
Wiederholen wir noch die Kennzeichen dieser falschen Propheten: Jeder, der die Erbsünde und die Erlösungsbedürftigkeit der Menschheit leugnet, unterhöhlt dadurch die Bedeutung des Todes Christi am Kreuz und ist ein falscher Prophet. Jeder, der nicht mehr sieht, daß die Erlösung der Welt durch Christus die letzte Quelle wahren Glücks ist und daß nichts auf der Welt mit dieser einen glorreichen Tatsache verglichen werden kann, ist kein wahrer Christ mehr.
Jeder, der nicht mehr den absoluten Primat des ersten Gebotes Christ - Gott über alles zu lieben - anerkennt und behauptet, daß sich unsere Liebe zu Gott ausschließlich in unserer Liebe zum Nächsten ausdrücke, ist ein falscher Prophet. Wer nicht mehr versteht, daß die Sehnsucht nach der Ich-Du-Gemeinschaft mit Christus und die Umgestaltung in Christus das eigentliche Ziel unseres Lebens ist, ist ein falscher Prophet.
Wer behauptet, daß alle Moral sich nicht primär in der Beziehung der Menschen zu Gott offenbare, sondern in den Dingen, die die menschliche Wohlfahrt betreffen, ist ein falscher Prophet. Jeder, der in dem Übel, das wir unserem Nächsten zufügen, nur das Unrecht ihm gegenüber und nicht die Beleidigung Gottes sieht, ist der Lehre von falschen Propheten zum Opfer gefallen.<<
ElsaLaska - 29. Sep, 16:27
Aus dem Kapitel "Falsche Mitte":
>>Der Grund aber für diese Kurzsichtigkeit der Gleichstellung von zwei so unvergleichbaren Übeln kann sehr verschiedener Natur sein. Ich spreche hier nur von Fällen, in denen z. B. ein ganz orthodoxer Priester, der all die heutigen Häresien tief beklagt, dieser Theorie verfällt: daß beide Extreme gleich gefährlich seien und die Wahrheit in der Mitte liege. [Ja Ja.]
Ein Grund ist, daß die Mesotes-Theorie [Aristoteles: Die Tugend liegt in der Mitte zwischen zwei Extremen], die ja auf vielen Gebieten zutrifft, von vielen leichtsinnig auch auf Gebiete übertragen wird, wo sie in keiner Weise hinpaßt. Wir haben darüber im "Trojanischen Pferd" ausführlich gesprochen und gesagt, daß die Wahrheit nicht in der Mitte zwischen zwei Extremen liegt - sondern jenseits und über ihnen. Während ich sinnvoller Weise sagen kann, etwas soll nicht zu kalt und nicht zu warm sein, nicht zu hell und nicht zu dunkel, nicht zu salzig und nicht zu wenig gesalzen - hat es keinen Sinn zu sagen, man solle nicht zu fromm und nicht zu wenig fromm, zu tugendhaft oder zu wenig tugendhaft sein. Erst recht gibt es keinen Sinn zu sagen, der eine ist zu orthodox und der andere zu wenig - in der Mitte liegt die Wahrheit. Die Orthodoxie ist die Wahrheit und alle Häresien sind nicht Extremismus, sind nicht etwas Übertriebenes - sondern sie sind einfach falsch, mit der Offenbarung Christi unverträglich. Mag eine Häresie aus einer Überbetonung einer Wahrheit auf Kosten einer anderen psychologisch erwachsen: Sie selbst kann nie als Extremismus betrachtet werden, dem ein entgegengesetzter Extremismus von zu orthodox gegenübersteht - sondern sie ist eben falsch, unwahr.<<
ElsaLaska - 12. Sep, 21:02
aus dem Band "Liturgy and Personality", eingestellt von Shawn Tribe auf den Seiten von New Liturgical Movement. Aus dem Kapitel "The Spirit of Discretio".
Hier zum Nachlesen.ElsaLaska - 6. Sep, 20:43
>>Über die Ehe.
Die traditionelle Auffassung von der Ehe enthält eine unvollständige Wahrheit. Die übertriebene, ja beinahe ausschließliche Betonung des Aspektes der Prokreation führte zu einer weitgehenden und fast völligen Mißachtung der Rolle, die der gegenseitigen Liebe in der Ehe zukommt.
Jahrhunderte hindurch haben viele katholische Theologen (im Gegensatz z. B. zu einem hl. Franz von Sales) jede Erwähnung der spezifischen Natur der bräutlichen Liebe und ihrer tiefsten Bedeutung für die Ehe vermieden. Es war das große Verdient Papst Pius XII., die beredtesten Worte für die Natur und den Wert dieser besonderen Art von Liebe zu finden.
So richtig es war, den großen und edlen Zweck der Prokreation zu betonen, so kann man der Natur der Ehe doch nur gerecht werden, wenn man ebenfalls ihre Bedeutung und ihren hohen Wert als Liebesgemeinschaft begreift, als letzte Vereinigung zweier Personen. Ferner kann das Mysterium der Prokreation selbst nur adäquat begriffen werden, wenn man es auf dem Hintergrund dieser Liebesgemeinschaft erfaßt, wenn man es als die superabundante Frucht aus dieser Liebeseinheit sieht.
Es ist also klar, daß die Lehre, die ausschließlich die Prokreation betont, eine unvollständige Wahrheit ist; sie bedarf deshalb der Vervollständigung durch eine Lehre, die auch dem Wert der ehelichen Liebe gerecht wird.
Doch in Büchern und Artikeln, die progressistische Katholiken über die Ehe schreiben, begegnen wir nicht dieser Vervollständigung ..., sondern finden dort eher eine bloße Reaktion, die der früheren ausschließlichen Betonung der Prokreation einfach entgegengesetzt ist. Nicht nur wird der moralisch bedeutende Unterschied zwischen künstlicher Empfängnisverhütung und natürlicher Geburtenregelung nicht mehr gesehen, sondern man leugnet selbst die bräutliche Liebe im tiefsten Sinn dieses Wortes trotz all dem Preisen und dem Geschrei, das man um sie erhebt. Man erklärt sie durch das Schlagwort "Selbsterfüllung". Man übersieht das eigentliche Geheimnis des Sexuellen, weil man es bloß als biologischen Instinkt wie Hunger und Durst auffaßt und von hygienischen Gesichtspunkten aus betrachtet. Doch ... kann das Sexuelle nur verstanden werden, wenn man seinen dienenden Charakter der Liebe gegenüber begreift, seine Bestimmung als Ausdruck und Erfüllung bräutlicher Lieber. Die falsche Interpretation des Sexuellen öffnet Tür und Tor allen unseligen Irrtümern über die Ehe, bis zur Leugnung ihrer Unauflöslichkeit.<<
ElsaLaska - 1. Sep, 09:52
>>Wie verschieden auch die äußeren Lebensbedingungen sein mögen, so bleibt doch der Mensch grundsätzlich immer derselbe. Der Stand der Technik, der Medizin und der Organisation des gesellschaftlichen Lebens ist heute ein ganz anderer als im Mittelalter, aber die Quellen wahren Glücks auf Erden bleiben dieselben: Liebe, Wahrheit, Ehe, Familie, die Schönheit in Natur und Kunst, schöpferische Tätigkeit. Obwohl die Umwandlungen in der Geschichte viele neue Probleme stellen, finden wir dieselben grundlegenden metaphysischen Gegensätzlichkeiten zu allen Zeiten, dieselben Dramen im Leben des Menschen. Es ist tatsächlich wahr, daß man in der Geschichte das Aufkommen und Untergehen von Lebensstilen feststellen kann, die eine Zeitlang die Existenz der Menschen prägen und ihren Ausdruck in der Architektur, in Sitten, in Moden des Verhaltens und Denkens finden. Aber der Mensch ändert sich nicht in seinem Wesen, er bleibt denselben sittlichen Gefahren ausgesetzt; er ist zu allen Zeiten gleich erlösungsbedürftig und er ist zu allen Zeiten in gleicher Weise zu moralischer Vollkommenheit, ja sogar zur Heiligkeit berufen; für den Menschen aller Zeiten gelten die Worte des hl. Augustinus: "Du hast uns für Dich erschaffen, o Herr, und unser Herz ist unruhig, bis es ruhet in Dir."<<
ElsaLaska - 30. Aug, 11:02
In seiner Abhandlung "Der Sinn philosophischen Fragens und Erkennens" unternimmt Dietrich von Hildebrand eine Untersuchung des Erkennens als Urphänomen, stellt dabei grundlegend fest, dass das Erkennen nicht gedacht werden kann ohne ein bewusstes Sein, ohne ein personales Subjekt, ein bewusst Seiendes.
Er unterscheidet den Vorgang des Erkennens scharf vom Urteilen, vom Überzeugen und Behaupten. In einem weiteren Schritt arbeitet er heraus, dass die Grundformen der Erkenntnis in der Kenntnisnahme und im Haben des erkannten Gegenstandes bestehen. In einem dritten Abschnitt - um den geht es hier - grenzt er die Eigenart des philosophischen Erkennens gegenüber dem "vorwissenschaftlichen Erkennen" ab. Dabei führt er den Terminus "naives vorwissenschaftliches Erkennen" ein, was keine Wertung beinhaltet, sondern lediglich meint, dass es sich dabei um eine Art der Wahrnehmung handelt, die nicht vom Thema der Kenntnisnahme erfüllt ist, die geschieht, ohne dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, es erfolgt wie nebenbei, und ist somit unsystematisch und unkritisch. (Etwa wenn eine Köchin feststellt: Das Wasser kocht.) Eine weitere Unterart des vorwissenschaftlichen Erkennens ist das theoretische vorwissenschaftliche Erkennen, welches nicht den Gegenstand selbst sprechen lässt, sondern ihn durch Erfahrungen, Beobachtungen, Überlegungen und Schlüsse zu erfassen sucht. Diese Form hat wiederum zwei Modi, nämlich den organischen und den anorganischen Typus. Die Präliminarien sind umständlich, braucht es aber, um das folgende Zitat richtig einordnen und verstehen zu können:
>>Das Anorganische dieses theoretischen Erkennens liegt auf der Hand. Es knüpft nicht an das naive Kenntnisnehmen an, sondern es setzt sich souverän darüber hinweg.
Es geht nur ganz von "außen" und ohne jeden unmittelbaren Sachkontakt an das Seiende heran. Bei dieser Art theoretischen außerwissenschaftlichen und außerphilosophischen Erkennens wird der naive Sachkontakt entweder bewußt ausgeschaltet, was fälschlich für spezifisch kritisch gehalten wird, oder der naive Sachkontakt wird unvermerkt ignoriert; immer geht man von allgemeinen, scheinbar evidenten Tatbeständen aus und deduziert aus ihnen.
Jemand argumentiert etwa: Alle sittlichen Werte sind relativ; denn verschiedene Völker und Zeiten halten jeweils entgegengesetzte Haltungen für gut und schlecht. Hier wird mit völliger Ignorierung des im naiven Sachkontakt vorliegenden Aspektes der Werte von außen her, aus einer Prämisse, die man von anderen ohne tieferes Verstehen dieses eigentlichen Tatbestandes übernommen, in völlig unkritischer Weise gefolgert. Denn die Verschiedenheit vieler Ansichten über gut und bös präjudiziert ja an sich noch nichts in bezug auf die Relativität der Werte. Oder jemand argumentiert: Alle Werte sind relativ; denn wir können doch nicht mehr erkennen, als was uns so erscheint; in dem wir es erkennen, ist es doch immer auf unser subjektives Erkenntnisvermögen relativ. Hier wird eine einer falschen Philosophie entstammende Scheinselbstverständlichkeit kritiklos als Prämisse zugrundegelegt, und man hält sich dabei für besonders kritisch, weil man sich über den im naiven Sachkontakt vorliegenden Aspekt erhebt. Daß man im nächsten Augenblick über das sittliche Verhalten eines Menschen empört ist und damit den sittlichen Wert als etwas Objektives behandelt, wird entweder gar nicht bemerkt oder nicht als etwas empfunden, was uns stutzig zu machen braucht. Denn dieser Typus hält prinzipiell sein theoretisches Erkennen, das sich aus nicht stringenten Schlüssen, aus ungeprüften Prämissen ergibt, für viel vertrauenswürdiger als das naive Kenntnisnehmen.
In diesem anorganischen theoretischen vorwissenschaftlichen Erkennen ist die Heimat alles Dilettantismus, aller Scheinselbstverständlichkeit, aller "Kurzschlüsse", alles fadenscheinigen rationalistischen Theoretisierens. Hier wirkt sich die mangelnde Kritik in prinzipiell verhängnisvollerer Weise aus als beim naiven Kenntnisnehmen und selbst als beim organischen theoretischen Erkennen. Denn hier wird ein Geistesregister gezogen, dessen Bedeutung mit dem Grad echter Kritik steht und fällt. <<
Aus: Dietrich von Hildebrand: Der Sinn philosophischen Fragens und Erkennens.
ElsaLaska - 17. Aug, 21:11
Eine Untersuchung zum Wirklichkeitsverständnis bei Josef Pieper" lautete die Überschrift einer Rezension in Die Tagespost vom 6. August 2011 von Manfred Gerwing zur Dissertation von Henrik Holm über "Die Unergründlichkeit der kreatürlichen Wirklichkeit. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Philosophie und Wirklichkeit bei Josef Pieper", betreut von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz.
Einige Auszüge aus der Rezension, die mir interessant erschienen:
"Der Verfasser [der Dissertation] hat Mut zum Vergleich. Er setzt das Denken Piepers in Beziehung zu maßgeblichen philosophischen Entwürfen der Gegenwart; und zwar anhand der die Untersuchungen leitenden zentralphilosophischen Frage nach der Wirklichkeit."
Es folgt dann eine Erläuterung der einzelnen Abschnitte.
"Die Arbeit besticht insgesamt durch die Genauigkeit der Analyse und die Sorgfältigkeit der Sprache. Hier wird Piepers Denken nicht nur kritisch reflektiert, sondern auch im Gespräch mit Repräsentanten zeitgenössischer Philosophie und Theologie konstruktiv reformuliert."
Und schließlich:
"Die Wirklichkeit ist für den menschlichen Intellekt einerseits von erkenntnisleitender, andererseits auch von erkenntnisresistenter Dignität. Gerade so hält sie das philosophische, nach Wahrheit suchende Fragen des Menschen in Atem. Pieper unterstreicht diese Unergründlichkeit der Wirklichkeit und gewinnt dadurch jene kritische Kompetenz und Offenheit gegenüber allen endgültigen Antwortversuchen sowie systemischen und systematisch-geschlossenen Generalisierungen, die seine Philosophie in einem Maße für zeitgenössisches Denken anschlussfähig macht, die überrascht und erstaunt. Und darin besteht der Wert der vorliegenden Arbeit: diese verblüffende Anschlussfähigkeit der Philosophie Piepers so exemplarisch wie plausibel nachzuweisen. Überdies macht die Lektüre vorliegender Untersuchung Freude, ja, sie ermunter dazu, Piepers Werke .... noch einmal selbst in die Hand zu nehmen ..."
[Na also. Es geht doch.]
Henrik Holm: Die Untergründlichkeit der kreatürlichen Wirklichkeit. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Philosophie und Wirklichkeit bei Josef Pieper. Thelem Verlag, Dresden 2011.
ElsaLaska - 12. Aug, 14:32
7. Kapitel - Die Aufgabe des christlichen Philosophen heute
Fortsetzung des Zitats
von hier:
Ein anderer Typus von katholischen Philosophen verläßt die Burg des Thomismus nur, um irgendeiner modernen Philosophie zum Opfer zu fallen. Ohne die Wirklichkeit zu befragen, ohne daß er sich staunend dem Seienden öffnet, tauscht ein solcher Philosoph die vollständige Annahme des thomistischen Systems gegen eine vollständige - ebenso unkritischer - Annahme Heideggers oder Hegels, Kants, Deweys oder sogar Freud ein. Er verzweifelt nicht an der Möglichkeit, philosophische Wahrheit zu erreichen, aber er gibt sich irgendeiner Philosophie in derselben unkritischen Weise hin, wie zuvor dem Thomismus, nur mit dem großen Unterschied, daß die Philosophie, zu der er sich jetzt wendet, keine unvollständige Erkenntnis der Wahrheit, sondern ein Berg von vollständigen Irrtümern ist und eine Philosophie, die schon in ihrer Grundlage mit der Christlichen Offenbarung unverträglich ist, da sie gerade die notwendig von der göttlichen Offenbarung eingeschlossen Wahrheiten leugnet. Statt deshalb auf großen katholischen Denkern fußend, ein Denken zweiter Hand zu betreiben, denkt er jetzt zweiter Hand auf der Grundlage säkularer, z. T. sogar antichristlicher Philosophien. Abgesehen davon, daß er fortfährt, Denken zweiter Hand zu betreiben (wobei er eine bedauerliche konservative Tendenz beweist), vollzieht sich in seinem geistigen Leben ein tiefer Wandel. Denn jetzt sucht er in einem Denken Obdach, das grundsätzlich mit der Christlichen Offenbarung unverträglich ist und ihn deshalb in Versuchung bringt, den Wahrheiten der göttlichen Offenbarung zu widersprechen. ...
Ein dritter Typus moderner katholischer Philosophen glaubt, man könne einen engen Thomismus dadurch überwinden, daß man ein Gebräu aus Kant, Thomas und Hegel, oder einem anderen einflußreichen Denker herstellt. Diese Menschen gewahren nicht, dass die vorige Enge nicht aus dem Inhalt des Thomismus herrührte, sondern aus der irrigen Meinung, daß man in den festen Gefügen eines geschlossenen Systems auf alles eine Antwort finden könne.
Das Befragen der Wirklichkeit war oft durch ein bloßes Verteidigen eines Systems ersetzt worden. Ohne den wirklichen Grund für die frühere Enge zu verstehen, verfehlt auch dieser dritte Typus seine Überwindung. Statt zur Wirklichkeit zurückzugehen und sich vorurteilslos in das Gegebene zu versenken, glauben diese Menschen der Wahrheit näher zu kommen, wenn sie den Thomismus mit irgendeinem anderen System vermischen. Auch sie übersehen oft die absolute Unverträglichkeit vieler dieser neu herangezogenen Gedanken mit der göttlichen Offenbarung.
Die richtige Antwort des katholischen Philosophen heute erfordert einen tief ehrfürchtigen und organischen Kontakt mit den großen Einsichten der traditionellen Philosophie, verbunden mit einem ununterbrochenen Befragen der Fülle des Seienden selbst, in dem er versucht, die großen Wahrheiten, die in der Vergangenheit philosophisch erobert wurden, durch weitere Richtigstellungen, Differenzierungen und neue Einsichten zu vervollständigen. <<
ElsaLaska - 10. Aug, 20:08
7. Kapitel - Die Aufgabe des christlichen Philosophen heute
Zitat:
>>Auf dem Hintergrund dieser Analyse erhebt sich nun die Frage, welche Haltung der katholische Philosoph im jetzigen Augenblick einnehmen soll. So falsch es war, in einem strengen Thomismus eingesperrt zu bleiben, und jede philosophische These als Irrtum zu bekämpfen, die in dieses System nicht hineinpaßte; so schlimm es war zu glauben, alle philosophischen Fragen seien schon durch den Thomismus beantwortet, so ist doch die Einstellung noch schlimmer, der wir heute bei vielen progressistischen katholischen Philosophen begegnen. Unter diesen gibt es verschiedene Typen:
Da gibt es zunächt den Philosophen, der im Augenblick, da sein Glaube an den Thomismus als das letzte Wort in der Philosophie erschüttert wird, mehr oder weniger zum Relativisten wird. Die Desillusionierung, die er in Bezug auf den Thomismus erfährt, unterhöhlt seinen Glauben an philosophische Wahrheit als solche. Statt die großen Einsichten des hl. Thomas von verschiedenen Irrtümern zu befreien, statt alles in seiner Philosophie mit der Fülle des Seienden zu konfrontieren und so die vom hl. Thomas entdeckten Wahrheiten durch neue Unterscheidungen und Differenzierungen zu ergänzen, wird er ein historischer Relativist. Das ist offenbar das Gegenteil eines Fortschritts oder gar einer größeren geistigen Weite und Geöffnetheit. Ein solcher Mann gleicht vielmehr einem, der von der Frau, die er liebte, enttäuscht wurde und nun überhaupt an der Möglichkeit verzweifelt, eine Frau könne jemals treu sein.<<
ElsaLaska - 10. Aug, 15:14
Aus "Der Verwüstete Weinberg" von Dietrich von Hildebrand:
>>Es ist kein Zweifel, daß mit der Verlegung des Schwergewichts vom Jenseits in das Diesseits, von der Heiligung der individuellen Person auf die äußere Weltverbesserung, von der Ewigkeit auf die irdische Zukunft, eine Entpersonalisierung und ein Kollektivismus Hand in Hand geht. Sobald die Frage der glorificatio Gottes und der ewigen Seligkeit zurücktritt hinter dem "Fortschritt" der Welt und der Weltverbesserung, wird der letzte Ernst des Schicksals jeder einzelnen Seele nicht mehr verstanden, wird die unvergleichliche Überlegenheit der individuellen Person über alle natürlichen Gemeinschaften nicht mehr erkannt. So sagt Kardinal Newmann: "Die Kirche .. sieht das Tun dieser Welt und das Tun der Seele als einfach inkommensurabel an, wenn man sie ihrer verschiedenen Ordnung nach betrachtet; sie würde lieber die Seele eines einzigen wilden Räubers in Kalabrien oder eines winselnden Bettlers in Palermo retten, als hundert Eisenbahnlinien kreuz und quer durch ganz Italien ziehen oder in allen Einzelheiten eine gesundheitliche Reform in jeder Stadt Siziliens durchführen, es sei denn, diese große nationalen Werke bezweckten darüber hinaus ein geistliches Gut."
Sobald man die unvergleichliche Bedeutung einer unsterblichen Seele gegenüber allen sozialen Verbesserungen und zivilisatorischen Fortschritten nicht mehr sieht, ist man dem Kollektivismus und der Entpersonalisierung zum Opfer gefallen. Man braucht nur an die unseligen Dialoge mit den Kommunisten zu denken, bei denen man durch den äquivoken Gebrauch des Terminus Zukunft eine illusionäre gemeinsame Basis finden will. Hier wird der Primat der Seele des Einzelnen völlig preisgegeben.<<
[DvH zitiert Newman aus "Die Kirche und der Zustand der Welt".]
ElsaLaska - 1. Aug, 09:48